 Am 18. November 1999, also heute vor genau zehn Jahren, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) in der Rechtssache Teckal entschieden. Die Entscheidung ist der Grundstein einer immer weiter differenzierten Rechtsprechung zu den so genannten Quasi-Inhouse-Geschäften, also vom Vergaberecht freigestellten Beschaffungsvorgängen. Ihr Jubiläum soll zum Anlass genommen werden, diese Rechtsprechung und ihre Interpretation und Rezeption mit Blick auf den vierten Teil des GWB in einer Artikelreihe zu resümieren. Der erste Teil stellt die vergaberechtliche Problematik dar und erläutert diese Grundsatzentscheidung des EuGH dazu.
Am 18. November 1999, also heute vor genau zehn Jahren, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) in der Rechtssache Teckal entschieden. Die Entscheidung ist der Grundstein einer immer weiter differenzierten Rechtsprechung zu den so genannten Quasi-Inhouse-Geschäften, also vom Vergaberecht freigestellten Beschaffungsvorgängen. Ihr Jubiläum soll zum Anlass genommen werden, diese Rechtsprechung und ihre Interpretation und Rezeption mit Blick auf den vierten Teil des GWB in einer Artikelreihe zu resümieren. Der erste Teil stellt die vergaberechtliche Problematik dar und erläutert diese Grundsatzentscheidung des EuGH dazu.
Teil 1: Die Basics
Alle Erwägungen zu Inhouse-Geschäften (der Begriff Inhouse-„Vergabe“ ist irreführend, da ja Vergaberecht gerade keine Anwendung findet) setzen bei § 99 Abs. 1 GWB an. Die Norm definiert den Öffentlichen Auftrag als einen Vertrag zwischen einem öffentlichen Auftraggeber und einem Unternehmen. Vertragspartner sind also zwei unterschiedliche Rechtssubjekte. Bei internen Vorgängen liegt hingegen kein Öffentlicher Auftrag vor. Sie haben keinen Marktbezug und sind deshalb vom Vergaberecht freigestellt.
Echte Inhouse-Geschäfte
Diese internen Vorgänge ohne Marktbezug können untechnisch als echte Inhouse-„Geschäfte“ bezeichnet werden. Darunter sind all die „Geschäfte“ zu verstehen, die von dem öffentlichen Auftraggeber unmittelbar selbst (z.B. durch eigene Abteilungen, aber auch im Rahmen eines rechtlich nicht selbständigen Regie- oder Eigenbetriebs) erbracht werden.
Quasi Inhouse-Geschäfte
Hiervon zu unterscheiden sind Geschäfte bei denen als „Geschäftspartner“ eine „Organisationseinheit“ gewählt wird, die (formal) juristisch gesehen eine rechtlich selbstständige Person darstellt, mit dem Auftraggeber aber verbunden ist. Die juristische Selbständigkeit macht es notwendig, dass zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und der „Organisationseinheit“ ein Vertrag geschlossen wird. Das spricht – zumindest nach dem Wortlaut des § 99 Abs. 1 GWB – für eine Eröffnung des Anwendungsbereichs des Vergaberechts. Die (häufig sehr enge) Bindung zum Auftraggeber spricht indes für eine Freistellung vom Vergaberecht.
Argumentativ kann dieses Spannungsverhältnis durch das Kriterium der so genannten funktionalen Identität aufgelöst werden. Wenn der Auftraggeber den ansonsten auszuschreibenden Auftrag mit eigenen Mitteln erfüllen möchte und kann, dann macht es in der Sache keinen Unterschied, ob das durch einen Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder z.B. eine rechtlich selbständige Eigengesellschaft geschieht. Derartige Geschäfte sind den echten Inhouse-„Geschäften“ vergleichbar, weil sie funktional identisch sind. Ein Vertrag ist letztlich nur wegen der rechtlichen Unterscheidbarkeit notwendig, nicht aber wegen eines echten Drittstatus des Auftragnehmers. Sie werden deshalb „Quasi-Inhouse-Geschäfte“ genannt und wie echte Inhouse-„Geschäfte“ bewertet, sind also dem Vergaberecht entzogen. Rechtstechnisch wird mit einer teleologischen Reduktion sowohl des Auftrags- als auch des Unternehmensbegriffs in § 99 GWB gearbeitet.
Wird eine Leistung z.B. durch eine Eigengesellschaft einer Gemeinde erbracht, handelt es sich immer noch um eine Form der Selbsterbringung der Leistung und nicht um eine Beschaffung am Markt. Besteht funktionale Identität mit echten Inhouse-Geschäften ist eine Freistellung vom Vergaberecht gerechtfertigt.
Die Teckal-Entscheidung
Aber natürlich gibt es nicht nur Konstellationen, in denen ein Vertragsschluss ganz offensichtlich nur als bloßer Formalismus angesehen werden kann.
Vergaberechtlich spannend wird es insbesondere dann, wenn z.B. mehrere Gemeinden Anteile am avisierten Auftragnehmer halten oder gar Private hieran beteiligt sind. Ferner stellt sich die Frage, welche Auswirkungen es hat, wenn der avisierte Auftragnehmer zwar mit dem Auftraggeber eng verbunden ist, aber auch Leistungen für Dritte erbringt und so in Konkurrenz mit anderen am Markt tätigen Anbietern steht. Kurz: Es stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine „funktionale Identität“ und ein vom Vergaberecht freigestelltes Quasi-Inhouse-Geschäft noch angenommen werden kann und wann die Grenze zur Anwendbarkeit des Vergaberechts überschritten wird.
In der Rechtssache „Teckal“ (EuGH, Urt. v. 18.11.1999 – Rs. C-107/98 – „Teckal“ – NZBau 2000, 90) hat sich der EuGH mit dieser Frage erstmals auseinandergesetzt.
Der Sachverhalt
Die Teckal Srl (im Folgenden: Teckal) war ein privates Unternehmen, das Dienstleistungen im Heizungssektor erbrachte. Zu den Kunden der Teckal gehörte u.a. die italienische Gemeinde Viano. Diese war wiederum an der „Azienda Gas-Acqua Consorziale“ (im folgenden: AGAC) beteiligt. Bei der AGAC handelte es sich um ein Konsortium von Gemeinden zur Erbringung von Energie- und Umweltleistungen. Nach ihrer Satzung besaß sie Rechtspersönlichkeit und unternehmerische Selbständigkeit.
Der Rat der italienischen Gemeinde Viano hatte beschlossen, nunmehr die AGAC die Betreibung der Heizungsanlagen in bestimmten Gebäuden der Gemeinde und damit zusammenhängende Dienstleistungen vornehmen zu lassen. Ein Ausschreibungsverfahren wurde zu diesem Zweck jedoch nicht durchgeführt.
Das war natürlich nicht im Sinne der Teckal. Diese erhob beim Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna gegen die Gemeinde Viano und gegen die AGAC Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung des Gemeinderats. Sie machte geltend, die Gemeinde Viano hätte die im Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge einhalten müssen.
Das nationale Gericht legte dem EuGH u.a. die Frage vor, ob die Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Lieferaufträge (Richtlinie 93/36/EWG) – ob also europäisches bzw. das entsprechende europarechtlich induzierte nationale Vergaberecht – auf diesen Rechtsstreit anwendbar sei. Dann hätten die unmittelbar von der AGAC bezogenen Leistungen im Wege eines den Vorgaben der Richtlinie 93/36/EWG entsprechenden Verfahrens ausgeschrieben werden müssen.
Inhalt der Entscheidung
Der EuGH hat die Vorlagefrage dahingehend beantwortet, dass die Richtlinie 93/36/EWG grundsätzlich immer dann anwendbar sei, wenn ein öffentlicher Auftraggeber wie etwa eine Gebietskörperschaft beabsichtige, einen schriftlichen entgeltlichen Vertrag über die Lieferung von Waren mit einer Einrichtung zu schließen, die sich formal von ihm unterscheidet und die ihm gegenüber eigene Entscheidungsgewalt besitzt.
Allein die Beteiligung der öffentlichen Hand an einer juristischen Person des Privat- oder des öffentlichen Rechts sei nicht ausreichend, um ein Geschäft dem Anwendungsbereich des Vergaberechts zu entziehen. Das gelte auch dann, wenn diese Beteiligung dazu führe, dass diese juristische Person selbst als öffentlicher Auftraggeber (vgl. für Deutschland § 98 GWB) anzusehen sei. Es gebe keine allgemeine Ausnahme für Verträge mit Auftragnehmern, die selbst den Pflichten des Vergaberechts unterliegen. Das sei dem Vergaberecht fremd. Es sei deshalb unerheblich, ob die Auftragnehmereinrichtung selbst ein öffentlicher Auftraggeber ist.
Grundsätzlich sind also alle Geschäfte mit juristisch als Dritten zu betrachtenden Personen zunächst einmal dem Vergaberecht zu unterstellen. Der EuGH statuiert allerdings zwei wesentliche Ausnahmen, die kumulativ vorliegen müssen. Ein Anwendung von Vergaberecht kommt dann nicht in Betracht, wenn der öffentliche Auftraggeber
- über die rechtlich von ihm verschiedene Person, also den Vertragspartner, eine Kontrolle ausübt wie über seine eigenen Dienststellen (so genanntes erstes „Teckal-Kriterium“ oder „Kontrollkriterium“) und
- wenn diese Person zugleich ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Gebietskörperschaft oder die Gebietskörperschaften verrichtet, die ihre Anteile innehaben (so genanntes zweites „Teckal-Kriterium“ oder „Wesentlichkeitskriterium“).
(Nur) diese Art der „Beauftragung“ ist also funktional der Aufgabenwahrnehmung durch eine eigene Dienststelle, also dem echten Inhouse-„Geschäft“, gleichzusetzen und wie dieses als dem Vergaberecht entzogener verwaltungsorganisatorischer Vorgang zu werten.
Beide Teckal-Kriterien lassen Raum für die gegensätzlichsten subjektiven Auslegungen. Diese sind Gegenstand einer genaueren Betrachtung in den folgenden Teilen dieses Beitrags. Bitte beachten Sie: Fortan wird es für solche tiefgehenden und ggfs. mehrteiligen Auseinandersetzungen zu einem Thema eine eigene Kategorie „Analyse“ (siehe Auswahl oben Links) im Vergabeblog geben.




 (17 Bewertungen, durchschn.: 4,47aus 5)
(17 Bewertungen, durchschn.: 4,47aus 5)








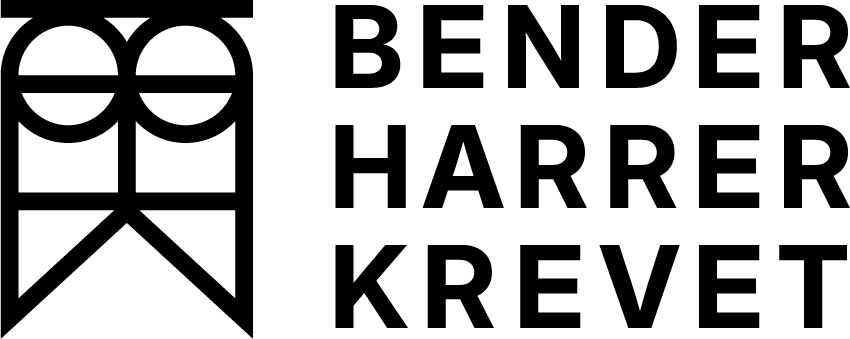

Schreibe einen Kommentar