 Eignungskriterien müssen transparent sein. Intransparente Eignungskriterien führen zur Zurückversetzung. In einem vom OLG Frankfurt a.M. zu entscheidenden Fall ist zurückversetzt worden, obwohl das OLG der Meinung war, dass sich die bekannt gemachten Kriterien aus Sicht eines verständigen, durchschnittlich erfahrenen Bieters so hätten auslegen lassen können, dass sie zulässig gewesen wären. Mit diesem auf den ersten Blick merkwürdigen Ergebnis befasste sich bereits der Autor Martin Adams in dessen Blogbeitrag (). Hier soll aufgezeigt werden, warum die Entscheidung des OLG Frankfurt abweichend von der Einschätzung des Kollegen Adams logisch und folgerichtig war.
Eignungskriterien müssen transparent sein. Intransparente Eignungskriterien führen zur Zurückversetzung. In einem vom OLG Frankfurt a.M. zu entscheidenden Fall ist zurückversetzt worden, obwohl das OLG der Meinung war, dass sich die bekannt gemachten Kriterien aus Sicht eines verständigen, durchschnittlich erfahrenen Bieters so hätten auslegen lassen können, dass sie zulässig gewesen wären. Mit diesem auf den ersten Blick merkwürdigen Ergebnis befasste sich bereits der Autor Martin Adams in dessen Blogbeitrag (). Hier soll aufgezeigt werden, warum die Entscheidung des OLG Frankfurt abweichend von der Einschätzung des Kollegen Adams logisch und folgerichtig war.
Sachverhalt
Die Vergabestelle schrieb mit EU-weiter Bekanntmachung vom 03.02.2023 die Übernahme und Verwertung von Bioabfällen im Umfang von ca. 9000 Mg pro Jahr im offenen Verfahren aus. Die Eignungswertung sollte im Kern anhand geforderter Referenzen erfolgen. Dazu hieß es wörtlich in der Bekanntmachung:
„Es sind zwei unternehmensbezogene Referenzen über vergleichbare, für kommunale Auftraggeber erbrachte Leistungen an entsprechender Stelle in der EEE (siehe jeweils den nachfolgenden Hinweis in den eckigen Klammern) anzugeben:
- Auftraggeber (Firma) [Empfänger]
- Zuständige Abteilung/Bereich [Empfänger]
- Umfang der erbrachten Leistung [Betrag in EUR]
- Ausführungszeitraum [Anfangsdatum; Enddatum]
- Kurze Beschreibung der erbrachten Leistung [Beschreibung]
- Die Referenzen müssen jeweils mindestens folgende Kriterien erfüllen, dazu hat der Bieter für jede Referenz den Leistungszeitraum und den Umfang (Tonnage) im Feld „Beschreibung“ mit anzugeben:
- Die erbrachten Leistungen müssen in Bezug auf die Leistungsgegenstände Tonnage ein ähnliches Volumen (mindestens jedoch 50% der Tonnage) aufweisen,
- über mindestens drei Jahre erbracht worden sein und
- aus den letzten fünf Jahren stammen.
Einzelne Referenzen können in Summe betrachtet werden, wenn sie in den letzten fünf Jahren eine zeitliche Überlappung von mindestens drei Jahren haben und in der Summe mindestens 50% der ausgeschriebenen Tonnage erreichen, sofern die Mindestkriterien nicht von einer einzigen Referenz erfüllt werden.
– Sofern Sie noch nicht oder nicht über hinreichende Referenzen im Bereich abfallwirtschaftlicher Leistungen verfügen, können Sie weitere Angaben machen, warum Sie sich/Ihr Unternehmen für ausreichend fachkundig und leistungsfähig für die Erbringung der abgefragten Leistungen halten. Bitte schildern Sie dies ausführlich, da Sie mit Ihren Angaben Ihre Fachkunde nachweisen müssen. Sie können daher auch als Anlage weitere geeignete Unterlagen, Bescheinigungen etc. einreichen. In jedem Fall müssen dann aber die für die Durchführung des Auftrages verantwortlichen Personen über persönliche Referenzen verfügen, die die Referenzen des Bieters zu ergänzen oder zu ersetzen geeignet sind […]“.
(OLG Frankfurt a. M. Beschl. v. 28.9.2023 – 11 Verg 2/23, BeckRS 2023, 31309 Rn. 3 f, beck-online)
In den Vergabeunterlagen, konkret dem Vertragsentwurf, ist eine Klausel enthalten, nach der der AG dem AN die Auswahl der Anlagentechnik bzw. die Auswahl des technischen Verfahrens zur Verwertung der Bioabfälle überlässt, wobei jedoch die Mietkompostierung ausgeschlossen sein soll. Der Intensivrotteprozess müsse danach eingehaust erfolgen.
Die Vergabestelle und spätere Antragsgegnerin beabsichtigt die Zuschlagserteilung an die spätere Beigeladene, was von der späteren Antragstellerin (der Bestandsauftragnehmerin) gerügt wird. Nach erfolgloser Rüge reicht die Antragstellerin Nachprüfungsantrag ein mit dem Ziel, die Antragsgegnerin zur Neubewertung der Angebote zu verpflichten, wobei das Angebot der Beigeladenen ausgeschlossen werden müsse, weil diese keine geeigneten Referenzen vorweisen könne.
Die VK Hessen hatte diesen Antrag mit Beschluss vom 15.05.2023 abgelehnt, was im Kern darauf gestützt wurde, dass durch Auslegung ermittelt werden könne, welche Eignungskriterien – konkludent – durch die in der Bekanntmachung dargestellten Referenzanforderungen gefordert waren. Insofern sei die Beurteilung der Ausschreibung aus Sicht eines durchschnittlich erfahrenen Bieters maßgebend.
Hiergegen legte die Antragstellerin sofortige Beschwerde ein mit der Begründung, das Angebot der Beigeladenen müsse schon deswegen zwingend ausgeschlossen werden, weil diese mit ihren Referenzen die geforderter Mindesttonnage von 9.000 Mg/a nicht erfüllen könne. Dementsprechend beantragte die Antragstellerin, die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Wertung der Angebote unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats zu wiederholen.
Die Entscheidung
Das OLG Frankfurt gibt der Antragstellerin in seinem Beschluss vom 28.09.2023 zwar Recht. Allerdings anders, als die Antragstellerin meint. Anstelle der Neubewertung entschied es, dass aufzuheben und zurückzuversetzen ist. Es stellt (zutreffend) dar, dass es gem. § 168 Abs. 1 S. 2 GWB nicht an die Anträge gebunden ist und unabhängig von diesen auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken kann. Das Ziel der Antragstellerin, den Zuschlag an die Beigeladene zu verhindern, sei jedenfalls auch dann erfüllt, wenn das Vergabeverfahren aufgehoben und in den Stand vor Bekanntmachung zurückversetzt wird.
Das OLG Frankfurt führt zur Begründung dessen aus, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren dadurch verletzt worden sind, dass die Referenzen der Beigeladenen aufgrund einer intransparenten Bestimmung in den Ausschreibungskriterien als ausreichender Eignungsnachweis akzeptiert wurden.
Das OLG Frankfurt erläutert den Kern seiner Argumentation dahingehend, dass die in Ziffer III.3 der Ausschreibungsunterlagen enthaltene Regelung in Bezug auf die dort angebotene Summierungsoption für die Referenzen intransparent war. Aufgrund dieser Intransparenz konnte das OLG keine eigene Entscheidung treffen, weil allein die Vergabestelle berechtigt ist, Eignungskriterien vorzugeben. Sind die gewählten Eignungskriterien intransparent – so das OLG Frankfurt – komme daher nur die Zurückversetzung in Betracht.
Die Intransparenz der Eignungskriterien ergibt sich mit den Entscheidungsgründen des OLG Frankfurt aus folgenden Überlegungen: Gefordert war in der Auftragsbekanntmachung, dass zwei unternehmensbezogene Referenzen vorzulegen sind, die „jeweils 50% der Tonnage“ umfassen, sodass in Summe die streitgegenständliche (Gesamt-) Tonnage von 9.000 Mg/a erreicht wird. Diese Mindesttonnage sei auch dann gefordert gewesen, wenn die Bieter von der im Folgeabsatz genannten Möglichkeit einer Summierung von Einzelreferenzen Gebrauch machen wollten. Insofern habe die Auftragsbekanntmachung die unmissverständliche Vorgabe erhalten, dass beide Referenzen jeweils mindestens 50% der Auftragstonnage erreichen müssen, also mindestens jeweils 4.500 Mg/a. Insgesamt werde, so das OLG Frankfurt, aus den Ausschreibungsunterlagen deutlich, dass der Auftraggeber nur eine Summierung „innerhalb“ der geforderten Referenzen erlauben wollte, jedoch damit keinesfalls eine Verringerung des nachzuweisenden Gesamtvolumens einhergehen sollte. Andere Auslegungen der Vergabeunterlagen wären widersprüchlich – hierauf soll aber im Detail nicht eingegangen werden.
Denn für das OLG Frankfurt war dann weiter maßgebend, dass die Beigeladene die aus Sicht des OLG Frankfurt eindeutigen Eignungskriterien nicht erfüllt hatte, weil diese lediglich Referenzen über eine Menge von 5.700 Mg/ a vorlegen konnte. Dies führe nur deswegen nicht zu ihrem Ausschluss, sondern zur Aufhebung, weil die Ausschreibungsbedingung im Ergebnis intransparent aufgestellt worden sei.
Entscheidend für das OLG Frankfurt war, dass der Antragsgegner selbst erklärt hatte (vgl. OLG Frankfurt a. M. Beschl. v. 28.9.2023 – 11 Verg 2/23, BeckRS 2023, 31309 Rn. 52, beck-online), dass mit der Wahl der Aufsummierung von Referenzen auch eine Herabsetzung des Mindestvolumens von 9.000 Mg/a auf 4.500 Mg/a verbunden gewesen sei. Das OLG führt weiter aus, dass der Antragsgegner dies aber von der Zielrichtung nicht begründet habe und sich scheinbar bei Abfassung der Vergabeunterlagen keine näheren Gedanken über die Bedeutung und den Anwendungsbereich dieser Summierungsoption gemacht habe. Dieses Verständnis des Antragsgegners widerspreche dem Verständnis, das ein verständiger Bieter bei Durchsicht der Vergabeunterlagen hätte haben müssen – insbesondere weil dieses auftraggeberseitige Verständnis im Verstoß gegen § 122 Abs. 4 GWB den notwendigen Auftragsbezug vermissen lasse und damit zu einer unzulässigen Referenzforderung geführt hätte.
Zusammengefasst ausgedrückt: Die Vergabestelle hat in ihren Vergabeunterlagen nicht das formuliert was sie tatsächlich gewollt hatte. Deswegen sah das OLG die Eignungskriterien als intransparent an und glaubte deswegen, seine Auslegung nicht verbindlich vorgeben zu können: Weil der Auftraggeber selbst erklärt hatte, dass er die vom OLG verstandene Anforderung so gar nicht gewollt hat.
Rechtliche Würdigung
Die Regelung in § 122 Abs. 4 S. 2 GWB (als Ausprägung des sich auch aus § 97 Abs. 1 GWB ergebenden Transparenzgrundsatzes) verlangt, dass die Eignungskriterien bereits in der Auftragsbekanntmachung aufzuführen sind. Daraus folgt, dass die Eignungskriterien bei objektiver Betrachtung eindeutig und unmissverständlich formuliert sein müssen, sodass jeder durchschnittlich fachkundige Bieter sie in gleicher Weise versteht. Fehlt es an der notwendigen Transparenz, ist das Verfahren regelmäßig in den Stand vor Bekanntmachung zurückzuversetzen. Unklarheiten gehen zu Lasten des öffentlichen Auftraggebers. (Vgl. nur: VK Bund, Beschluss vom 22.07.2015, VK 2-61/15, IBRRS 2015, 2485.) Zwar ist die Aufhebung des Vergabeverfahrens „ultima ratio“, jedoch kommt sie immer dann in Betracht, wenn die Ausschreibung an einem im laufenden Verfahren nicht korrigierbaren Mangel schwerwiegender Art leidet. Geht man von einem Verstoß gegen den Transparenzgrundsatz aus, dann ist bereits fraglich, ob nicht der Teilnehmerkreis aufgrund der intransparenten Bekanntmachung bereits eingeschränkt war und insofern ein nicht anders, als durch Aufhebung heilbarer Mangel vorlag. Hinzu kommt, dass auch den teilnehmenden Bietern aufgrund der intransparenten Klausel möglicherweise die Chance genommen wurde, noch ausreichende Referenzen beizufügen – etwa durch eignungsleihende Nachunternehmer, die noch in Anspruch hätten genommen werden können.
Nimmt man also mit dem OLG Frankfurt eine intransparente Regelung zu den Referenzen an, dann ist die Folge – Aufhebung – nachvollziehbar und dann kommt insbesondere die bloße Wiederholung der Wertung nicht in Betracht.
Entscheidend ist insofern, ob die zentrale Begründung des OLG Frankfurt – die an sich verständliche Klausel sei vom öffentlichen Auftraggeber so gar nicht gemeint und gewollt (und das vom AG Gemeinte und Gewollte zudem rechtswidrig) gewesen und deswegen intransparent – tatsächlich begründen kann, es habe eine intransparente Klausel vorgelegen. Anders ausgedrückt geht es um die Frage, ob etwas, das objektiv für einen durchschnittlichen Bieter hinreichend klar ist, dadurch intransparent im Sinne von § 122 Abs. 4 GWB wird, dass der öffentliche Auftraggeber ein ganz anderes Verständnis zu Grunde gelegt hat (und anwenden wollte).
Um die Frage beantworten zu können, muss auf den Sinn und Zweck des Transparenzgrundsatzes zurückgegriffen werden. Er soll als Ausformung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sicherstellen, dass willkürliche Entscheidungen des Auftraggebers oder „Günstlingswirtschaft“ unterbleiben. (Statt aller: Ziekow in: Ziekow / Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 97 GWB Rn. 39 m.w.N.)
Dementsprechend ist durch die Rechtsprechung anerkannt, dass Bieter nicht vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden dürfen, wenn sich nicht schon aus den Vergabeunterlagen, sondern erst durch behördliche oder gerichtliche Auslegung der Verstoß gegen eine konkrete Verpflichtung ermitteln lässt. In diesen Fällen steht der Transparenzgrundsatz einem Ausschluss entgegen. Ebenfalls anerkannt ist, dass in sich widersprüchliche Vergabeunterlagen intransparent sind. Denn wenn den Bietern nicht klar ist, auf welcher Grundlage sie ihre Angebote erstellen müssen, besteht nicht die Gewissheit, dass vergleichbare Angebote in die Wertung eingehen können. (Vgl. VK Bund, Beschluss vom 17.11.2014, VK 2-77/14, IBRRS 2015, 0010.)
Überträgt man diese Grundsätze und die genannte Rechtsprechung auf den Fall des OLG Frankfurt, wird dessen Entscheidung gut nachvollziehbar: Wenn der öffentliche Auftraggeber eine ganz andere Anforderung an die Eignung aufstellen wollte, als das, was er dann in die Bekanntmachung niedergeschrieben hat, dann wird er in Konsequenz auch bei der Bewertung dieser Anforderungen nicht das Verständnis anwenden, was ein verständiger Bieter bei Abfassung seines Angebots haben musste. Ähnlich wie bei in sich widersprüchlichen Angaben kann der Bieter objektiv nicht das anbieten, was subjektiv vom Auftraggeber gefordert war. Das führt zwangsläufig dazu, dass der Auftraggeber in der Wertung nicht das bewertet, was er bewerten musste, nämlich die bekannt gemachte (anstelle der nur gewollten) Anforderung. Es liegt insofern nicht nur eine falsche Anwendung des bekanntgemachten Anforderungsniveaus durch den öffentlichen Auftraggeber vor, sondern der Fall, in dem der öffentliche Auftraggeber etwas bekannt gemacht hat, was er gar nicht hat bekannt machen wollen.
Ist das eigentlich Gewollte (wie hier) dann auch noch rechtswidrig, wird – mit dem Zweck des Transparenzgrundsatzes willkürliche Entscheidungen zu verhindern – klar, dass der Fehler nicht nur in einer falschen Anwendung liegt, sondern in einer von Anfang an intransparenten Vorgabe. Eine willkürliche Entscheidung liegt mehr als nahe, wenn der öffentliche Auftraggeber etwas ganz anderes gemeint hat, als aus Sicht eines verständigen, durchschnittlich erfahrenen Bieters zu verstehen war, und wenn der Bieter mit dem Verständnis des Auftraggebers auch deswegen nicht rechnen konnte und musste, weil dieses Verständnis rechtswidrig gewesen wäre.
Praxistipp
Gerade bei so kritischen Punkten wie Eignungs- oder Zuschlagskriterien sollte der Grundsatz „bekannt und bewährt“ besser nicht beachtet werden. Es ist, wie auch das OLG Frankfurt feststellte, vollkommen unerheblich, dass eine Formulierung für eine Eignungsanforderung in vielen Verfahren unbeanstandet geblieben ist. Der Maßstab der §§ 97 Abs. 1 und 122 Abs. 4 GWB verlangt eindeutige Formulierungen, die von allen Bietern in gleicher Weise verstanden werden können. Insofern bietet sich nicht nur eine sorgfältige Abfassung eben dieser Formulierungen an, sondern auch eine regelmäßige (Selbst-) Kontrolle, ob die „Standardklauseln“ auch wirklich das meinen und bewirken, was sie sollen.
Zum hier vorliegenden Fall lässt sich eine analoge Überlegung aus dem allgemeinen Teil des BGB heranziehen: Wer einem Erklärungs- oder Inhaltsirrtum im Sinne des § 119 Abs. 1 BGB unterliegt, kann die Erklärung anfechten. Ergebnis der Anfechtung ist nicht, dass eine Erklärung mit dem Inhalt des tatsächlich gewollten fingiert wird, sondern dass das angefochtene Rechtsgeschäft als von Anfang an nichtig anzusehen ist.
Die Entscheidung des OLG Frankfurt hat nicht zur Folge, dass öffentliche Auftraggeber sich darauf beschränken sollten „vergleichbare Referenzen“ zu fordern. Vielmehr lautet sie viel simpler, dass öffentliche Auftraggeber die gewollten Anforderungen auch bekannt machen sollen und dass sie die Pflicht haben zu prüfen, ob die gewollten Anforderungen rechtmäßig sind. Für die Praxis beschreibt das OLG Frankfurt also keine grundlegend neue Erkenntnis, sondern bestätigt vielmehr die hohen Maßstäbe, die bei der Aufstellung von Eignungsanforderungen zu beachten sind.
Carl-Henning Clodius
Der Autor Carl-Henning Clodius ist Rechtsanwalt in Rostock, seit 2021 ist er Fachanwalt für Vergaberecht. Er berät vorwiegend öffentliche Auftraggeber und Zuwendungsempfänger bei der Durchführung von Vergabeverfahren und Abwicklung von Beschaffungen, vertritt aber auch Bieter in Vergabenachprüfungsverfahren.

 (36 Bewertungen, durchschn.: 4,83aus 5)
(36 Bewertungen, durchschn.: 4,83aus 5)






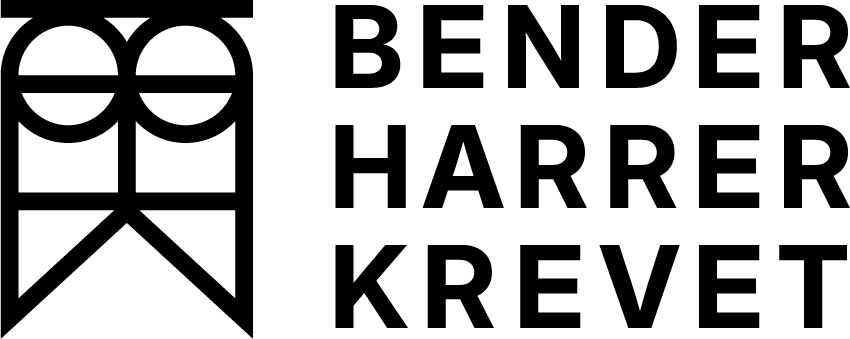

Schreibe einen Kommentar