 Der Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Ein in der Praxis regelmäßig herangezogener Grund ist, dass gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c VgV aufgrund von Ausschließlichkeitsrechten, beispielsweise Urheberrechten, nur ein bestimmtes Unternehmen den Auftrag ausführen kann. Der EuGH hat sich jüngst mit der Frage befasst, ob ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb auch dann durchgeführt werden darf, wenn der Auftraggeber selbst für das Alleinstellungsmerkmal verantwortlich ist. Die Entscheidung verschärft die Anforderungen für Ausnahmen vom Wettbewerb erneut.
Der Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Ein in der Praxis regelmäßig herangezogener Grund ist, dass gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c VgV aufgrund von Ausschließlichkeitsrechten, beispielsweise Urheberrechten, nur ein bestimmtes Unternehmen den Auftrag ausführen kann. Der EuGH hat sich jüngst mit der Frage befasst, ob ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb auch dann durchgeführt werden darf, wenn der Auftraggeber selbst für das Alleinstellungsmerkmal verantwortlich ist. Die Entscheidung verschärft die Anforderungen für Ausnahmen vom Wettbewerb erneut.
Leitsatz
Art. 31 Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/18/EG ist dahin auszulegen, dass sich der öffentliche Auftraggeber zur Rechtfertigung des Rückgriffs auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Sinne dieser Vorschrift nicht auf den Schutz von Ausschließlichkeitsrechten berufen kann, wenn der Grund für diesen Schutz ihm zuzurechnen ist. Eine solche Zurechenbarkeit ist nicht nur auf der Grundlage der den Abschluss des Vertrags über die ursprüngliche Leistung begleitenden tatsächlichen und rechtlichen Umstände, sondern auch auf der Grundlage derjenigen Umstände zu beurteilen, die den Zeitraum vom Vertragsschluss bis zu dem Zeitpunkt kennzeichnen, zu dem der öffentliche Auftraggeber das Verfahren zur Vergabe eines nachfolgenden öffentlichen Auftrags auswählt.
Sachverhalt
Das tschechische Finanzministerium schloss im Jahr 1992 mit einem Tochterunternehmen des IT-Konzerns IBM (Vertragspartner) einen Vertrag über die Errichtung eines Informationssystems für die Steuerverwaltung ab. Ein wettbewerbliches Auswahlverfahren wurde nicht durchgeführt. Der Vertragspartner behielt sich in dem Vertrag die Lizenzrechte für das System vor.
Im Jahr 2016 vergab der öffentliche Auftraggeber, der zwischenzeitlich an die Stelle des Finanzministeriums getreten war, im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb einen Wartungsvertrag für das System an eine Tochtergesellschaft des ursprünglichen Vertragspartners. Dieser Vertrag hatte einen Wert von rund EUR 1,3 Mio. Die Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb begründete der Auftraggeber damit, dass das Informationssystem aufgrund der ausschließlichen Urheberrechte des Vertragspartners am Quellcode ansonsten unbrauchbar geworden wäre. In diesem Fall hätte die Steuerverwaltung ihre Aufgabe nicht erfolgreich erfüllen können. Die Beschaffung eines neuen Systems sei finanziell nicht sinnvoll.
Das tschechische Wettbewerbsamt hat gegen dieses Vorgehen eine Beschwerde eingelegt. Im Rahmen des darauf folgenden Rechtsstreits hat das Oberste Verwaltungsgericht der Tschechischen Republik dem EuGH eine Vorabentscheidungsfrage vorgelegt. Es möchte wissen, ob bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb für einen Folgeauftrag auch die rechtlichen und tatsächlichen Umstände des ursprünglichen Vertragsschlusses zu berücksichtigen sind.
Die Entscheidung
Da das Verfahren zur Vergabe des Wartungsvertrags noch vor Inkrafttreten der Richtlinie 2014/24/EU begonnen wurde, prüfte der EuGH die Vorlagefrage auf Grundlage der Richtlinie 2004/18/EG. Der EuGH stellte zunächst unter Verweis auf seine bisherige Rechtsprechung klar, dass das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb Ausnahmecharakter hat und die Vorschrift daher eng auszulegen ist.
Der Gerichtshof ist weiter zu dem Ergebnis gekommen, dass sich ein Auftraggeber nicht auf eine Ausschließlichkeitssituation berufen kann, wenn ihm diese selbst zuzurechnen ist. Mit anderen Worten kann ein Auftraggeber die mit einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb einhergehende Beschränkung des Wettbewerbs nur dann rechtfertigen, wenn er nicht selbst für das dieses Verfahren begründende Ausschließlichkeitsrecht verantwortlich ist. Eine solche Einschränkung, so der EuGH, ergebe sich zwar nicht aus dem Wortlaut der zugrunde liegenden Vorschrift. Diese Auslegung folge aber aus dem Grundsatz der engen Auslegung von Ausnahmebestimmungen und den Zielen der Richtlinie, namentlich der Gewährleistung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie der Öffnung des öffentlichen Auftragswesens für den Wettbewerb in allen Mitgliedstaaten.
Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb scheidet nach Auffassung des Gerichtshofs nicht nur dann aus, wenn der Auftraggeber die Ausschließlichkeitssituation zur Erreichung seines Beschaffungsziels nicht herbeiführen musste. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber über tatsächliche und wirtschaftlich vertretbare Mittel verfügte, um diese Situation zu beenden. Den Auftraggeber trifft die Beweislast dafür, dass die vom EuGH aufgestellten Zurechnungsvoraussetzungen nicht vorliegen, er die Ausschließlichkeitssituation mithin nicht selbst verantwortet hat. Für die Beurteilung, ob das Ausschließlichkeitsrecht dem Auftraggeber zuzurechnen ist, sind damit nicht nur die Umstände beim Abschluss des ursprünglichen Vertrags relevant. Maßgeblich sind vielmehr auch die tatsächlichen und rechtlichen Umstände bis zur Vergabe des Folgeauftrags. Eine Zurechnung setzt dabei nicht voraus, dass der Auftraggeber die Ausschließlichkeitssituation absichtlich geschaffen bzw. aufrechterhalten hat, um den Wettbewerb in zukünftigen Auftragsvergaben einzuschränken. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb kann vielmehr auch dann ausgeschlossen sein, wenn ein Auftraggeber das Vergaberecht nicht bewusst umgehen wollte.
Ob dem Auftraggeber in dem der Entscheidung des EuGH zugrunde liegenden Sachverhalt der erforderliche Nachweis der fehlenden Zurechenbarkeit gelingt, hat das vorlegende tschechische Gericht zu entscheiden.
Einordnung
Das Vorliegen eines Alleinstellungsmerkmals kann eine Leistung – teilweise für einen sehr langen Zeitraum – dem Wettbewerb entziehen. Daher unterliegt die Anerkennung von Alleinstellungsmerkmalen seit jeher engen Grenzen. Noch nicht abschließend geklärt war bislang, ob ein Auftraggeber auf ein wettbewerbliches Vergabeverfahren verzichten darf, wenn er für das Alleinstellungsmerkmal, auf das er sich beruft, selbst verantwortlich ist. Dies hat der Gerichtshof verneint.
Zwar hat sich der EuGH in seinem Urteil ausschließlich mit den Vorschriften einer mittlerweile außer Kraft getretenen Vergaberichtlinie befasst (Art. 31 Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/18/EG). Es sprechen jedoch weit überwiegende Gründe dafür, dass die aufgestellten Maßstäbe auch unter den heutigen Vergaberichtlinien (insbesondere Art. 32 Abs. 2 Buchst. b iii) der Richtlinie 2014/24/EU) gelten. Die Regelungen dazu, wann Ausschließlichkeitsrechte vorliegen, haben sich kaum verändert. Es sind hingegen zusätzliche Anforderungen an das Leistungsbestimmungsrecht hinzukommen. Es darf keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung geben und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter sein (vgl. für die nationale Umsetzung § 14 Abs. 6 VgV). Dies spricht dafür, dass die Anforderungen an ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb unter den aktuellen Vergaberichtlinien sogar strenger sind als zuvor und die Entscheidung des EuGH erst recht auf die heutige Vergaberichtlinie anwendbar ist. Wie bereits ausgeführt begründet der Gerichtshof seine Entscheidung zudem mit allgemeinen EU-primär- und vergaberechtlichen Grundsätzen, die auch unter den aktuellen Vergaberichtlinien fortgelten.
Die Entscheidung bezieht sich auf Alleinstellungsmerkmale aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten, in Deutschland umgesetzt unter anderem durch § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. c VgV. Gleichermaßen dürfte die Entscheidung auf eine Alleinstellung aus technischen oder künstlerischen Gründen gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a und b VgV übertragbar sein. Die Begründung des EuGH gibt keinen Anlass, zwischen den unterschiedlichen Alleinstellungsmerkmalen zu differenzieren.
Mit seinem Urteil bricht der EuGH mit der bislang vielfach vertretenen Auffassung, dass – sobald ein öffentlicher Auftrag nicht mehr im Wege eines Nachprüfungsverfahrens angegriffen werden kann – die Umstände seines Zustandekommens der vergaberechtlichen Überprüfung entzogen sind. Die bislang vertretene Ansicht hat jüngst der Generalanwalt beim EuGH in seinen Schlussanträgen zur Zulässigkeit einer Auftragserweiterung gestützt (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts v. 17. Oktober 2024, C-452/23). Auch hat beispielsweise das OLG Düsseldorf im Jahr 2012 ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb für die Erweiterung des Ursprungssystems aufgrund einer fehlenden Schnittstelle gebilligt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 1. August 2012, Verg 10/12). Ob es dem Auftraggeber möglich gewesen wäre, bei der Ursprungsvergabe eine Schnittstelle zu verlangen und damit das Alleinstellungsmerkmal für die Erweiterung zu verhindern, hat der Vergabesenat nicht geprüft. Dass dies nicht der Fall war, wäre auf Grundlage der Entscheidung des EuGH zwingend vom Auftraggeber nachzuweisen gewesen.
Es wurde – allerdings vereinzelt – bereits in der Vergangenheit in der Entscheidungspraxis von Vergabekammern ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb mit der Begründung für unzulässig gehalten, dass der Auftrag, auf dem das Alleinstellungsmerkmal beruht, im Wege einer rechtswidrigen Direktvergabe abschlossen wurde (vgl. VK Bund, Beschl. v. 9. Mai 2014, VK 2 – 33/14; VK Niedersachsen, Beschl. v. 11. Oktober 2019, VgK-29/2019). Auch das Hanseatische Oberlandesgericht hat in einer aktuellen Entscheidung zur Zulässigkeit eines Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb die Ursprungsbeschaffung berücksichtigt. Allerdings hat der Senat nur geprüft, ob der Auftraggeber damals in der Absicht gehandelt hat, bei späteren potenziellen weiteren Beschaffungen andere Anbieter ausschließen zu können (vgl. Hanseatisches OLG, Beschl. v. 6. April 2023, 1 Verg 1/23). Nach der Entscheidung des EuGH soll es jedoch gerade nicht darauf ankommen, ob der Auftraggeber das Alleinstellungsmerkmal absichtlich herbeigeführt hat. Eine Verantwortlichkeit, die die Berufung auf das Alleinstellungsmerkmal ausschließt, setzt weder eine rechtswidrige Ursprungsvergabe noch eine bewusste Umgehung des Vergaberechts voraus.
Die Entscheidung lässt sich damit durchaus als „Paradigmenwechsel“ ansehen – nicht zuletzt, weil Auftraggebern dadurch erhebliche und langjährige Dokumentations- und Aufbewahrungsobliegenheiten aufgebürdet werden, die bei Altverträgen kaum erfüllt sein dürften.
Praktische Folgen
Eine Berufung auf ein Alleinstellungsmerkmal scheidet insbesondere dann aus, wenn eine oder beide der folgenden Fallgruppen einschlägig sind:
1. Der Auftraggeber musste beim Abschluss des ursprünglichen Auftrags das Alleinstellungsmerkmal nicht herbeiführen
Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist zum einen ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber die ursprüngliche Beschaffung, auf die das Alleinstellungsmerkmal zurückzuführen ist, so hätte ausgestalten können, dass es nicht zu einem Alleinstellungsmerkmal kommt. Um sich bei Folgeaufträgen auf ein Alleinstellungsmerkmal berufen zu können, muss ein Auftraggeber bereits vor der ursprünglichen Beschaffung prüfen, ob im Zusammenhang mit der Leistung zukünftig potenziell weiterer Beschaffungsbedarf entsteht. Ist dies der Fall, obliegt es dem Auftraggeber, diesen bereits bei der Festlegung der Anforderungen an die ursprüngliche Leistung und der Ausgestaltung der Vertragsregelungen für den Ursprungsauftrag zu berücksichtigen und Alleinstellungsmerkmale zu vermeiden. Soweit das nicht möglich ist, ist eine sorgfältige Dokumentation der Gründe erforderlich. Über die Regelung des § 5 Abs. 4 VgV hinaus sollte die Dokumentation solange aufbewahrt werden, wie es noch zu Folgeverträgen kommen kann.
Der Entscheidung des EuGH kommt – wie in dem zugrunde liegenden Sachverhalt – unter anderem im Rahmen von IT-Beschaffungen Bedeutung zu. Ein Auftraggeber ist grundsätzlich gehalten, sich bei der Beschaffung von IT-Lösungen vertraglich die für Erweiterungen und Wartung erforderlichen Rechte einräumen zu lassen. Eine Ausnahme besteht, wenn es innerhalb des Anbieterkreises für die jeweilige Leistung keine Unternehmen gibt, die zu einer entsprechenden Einräumung von Rechten (beispielsweise Zugriff auf den Quellcode) bereit sind. Gerade bei marktmächtigen Anbietern von unverzichtbaren Standardanwendungen wird dies oft der Fall sein. Anders dürfte es jedoch regelmäßig bei der Beschaffung von Individualsoftware sein. Aber auch in anderen Sektoren ist die Entscheidung relevant. So sind Auftraggeber beispielsweise bei der Beschaffung von medizinischen Geräten grundsätzlich gehalten, eine Lösung zu wählen, die bei potenziellen Erweiterungen mit anderen Systemen kompatibel ist (bspw. durch Schaffung von Schnittstellen).
Umsichtige Auftraggeber dürften ohnehin bestrebt sein, das Entstehen von Alleinstellungsmerkmalen und einen damit verbundenen Vendor Lock-In zu vermeiden, um nicht der daraus resultierenden Verhandlungsmacht des Auftragnehmers ausgesetzt zu sein. Auf Grundlage der Entscheidung des EuGH stellt sich jedoch die Frage, in welchem Umfang Auftraggeber von einer gewünschten Ausgestaltung abweichen müssen, um ein Alleinstellungsmerkmal zu verhindern. Darf ein Auftraggeber beispielsweise auf eine Standardlösung zurückgreifen, wenn dadurch ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen wird? Oder muss er – gegebenenfalls unter Inkaufnahme von Zusatzkosten und unter Reduzierung des Anbieterkreises – eine Anpassung marktverfügbarer Lösungen dergestalt verlangen, dass ein Alleinstellungsmerkmal vermieden wird? Die Ausführungen des EuGH bleiben in dieser Hinsicht vage. Orientierung können die Maßstäbe des § 14 Abs. 6 VgV bieten: Wenn es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung zur Schaffung eines Alleinstellungsmerkmals gibt und dieses nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist, spricht vieles dafür, dass das Alleinstellungsmerkmal dem Auftraggeber nicht zugerechnet werden kann.
Auch wenn der EuGH sich mit dieser Frage nicht ausdrücklich befasst hat, dürfte ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb immer dann ausgeschlossen sein, wenn der Ursprungsauftrag im Wege einer Direktvergabe zustande gekommen ist, deren Rechtmäßigkeit der Auftraggeber nicht nachweisen kann. Wenn der Auftraggeber sich bei der Ursprungsvergabe nicht an das Vergaberecht gehalten hat, hat er nicht alles Erforderliche getan, um das Alleinstellungsmerkmal zu verhindern.
Erfahrungsgemäß bestand in der Vergangenheit ein deutlich geringeres Bewusstsein für das Thema Vendor Lock-In. Gerade für bereits lang zurückliegende Ursprungsverträge – wie im Ausgangsfall mehr als 30 Jahre – dürfte es häufig schwierig sein, nunmehr nachzuweisen, dass die Schaffung des Alleinstellungsmerkmals erforderlich war. Eine Dokumentation dürfte für solche Verträge vielfach nicht (mehr) vorliegen. Obwohl die Aufbewahrungsfrist des § 5 Abs. 4 VgV bereits seit Langem abgelaufen ist, scheidet eine Berufung auf das Alleinstellungsmerkmal dann aus.
2. Dem Auftraggeber ist oder war es vertretbar möglich, die Alleinstellung zu beenden
Zum anderen ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber nach Abschluss des Ursprungsvertrags die Alleinstellungstellung nicht beendet hat, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte. Um sich bei Folgeaufträgen auf ein Alleinstellungsmerkmal berufen zu können, muss der Auftraggeber also jedenfalls Verhandlungen mit dem Unternehmen über die für die Herstellung von Wettbewerb erforderlichen Rechte bzw. Leistungen durchführen. Allerdings dürften Unternehmen kaum ohne Gegenleistung bereit sein, ihr Alleinstellungsmerkmal und die daraus resultierende Verhandlungsposition aufzugeben. Auftraggebern obliegt es dann, tatsächlich und wirtschaftlich vertretbar mögliche Maßnahmen zu treffen. Da der EuGH in seiner Entscheidung keine Anhaltspunkte gegeben hat, welche Maßnahmen tatsächlich erforderlich und dem Auftraggeber wirtschaftlich (noch) zumutbar sind, bestehen auch in dieser Fallgruppe erhebliche Unsicherheiten: Welche Kosten müssen Auftraggeber aufwenden, um sich die für die Beendigung des Ausschließlichkeitsmerkmals erforderlichen Rechte einräumen zu lassen? Kann es sogar erforderlich sein, eine Kündigung auszusprechen und ein neues System zu beschaffen, obwohl das Bestehende noch funktionsfähig ist? Auch zur Beantwortung dieser Fragen bietet sich eine Orientierung an den Maßstäben des § 14 Abs. 6 VgV an.
Fazit
Auftraggeber sollten vor Einleitung eines Vergabeverfahrens prüfen, ob sich aus dem zu vergebenden Auftrag Alleinstellungsmerkmale für zukünftige Bedarfe ergeben können. Ist dies der Fall, empfiehlt es sich, bereits beim Ursprungsauftrag die strengeren Maßstäbe des § 14 Abs. 6 VgV zu Grunde zu legen. Sollte sich danach ein potenzielles zukünftiges Alleinstellungsmerkmal nicht verhindern lassen, sind die Gründe sorgfältig zu dokumentieren.
Gerade für weit zurückliegende Ursprungsverträge erschwert die Entscheidung des EuGH es Auftraggebern erheblich, sich auf ein Alleinstellungsmerkmal zu berufen. Oftmals wird es an den erforderlichen Nachweisen fehlen, dass dem Auftraggeber die Schaffung des Alleinstellungsmerkmals nicht zurechenbar war. In einem solchen Fall ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nicht (mehr) zulässig.
Kontribution
Dieser Beitrag wurde zusammen mit Frau Rechtsanwältin Hanna Sophie Kurtz verfasst.
Hanna Sophie Kurtz
Hanna Sophie Kurtz ist Rechtsanwältin in der Kanzlei BLOMSTEIN in Berlin. Sie berät deutsche und internationale Mandanten zu vergaberechtlichen und außenwirt-schaftsrechtlichen Fragestellungen. Ihre Tätigkeit umfasst die Beratung in Verfahren vor deut-schen und europäischen Gerichten sowie vor den Vergabenachprüfungsinstanzen.
Ramona Ader
Ramona Ader ist Rechtsanwältin in der Kanzlei BLOMSTEIN in Berlin und auf deutsches und europäisches Vergaberecht sowie EU-Beihilfe- und Zuwendungsrecht spezialisiert. Im Verga-berecht berät sie Bieter und öffentliche Auftraggeber in allen Phasen von Vergabeverfahren und begleitet diese in Nachprüfungsverfahren vor den Vergabenachprüfungsinstanzen.


 (19 Bewertungen, durchschn.: 4,11aus 5)
(19 Bewertungen, durchschn.: 4,11aus 5)








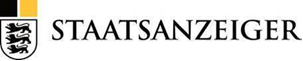
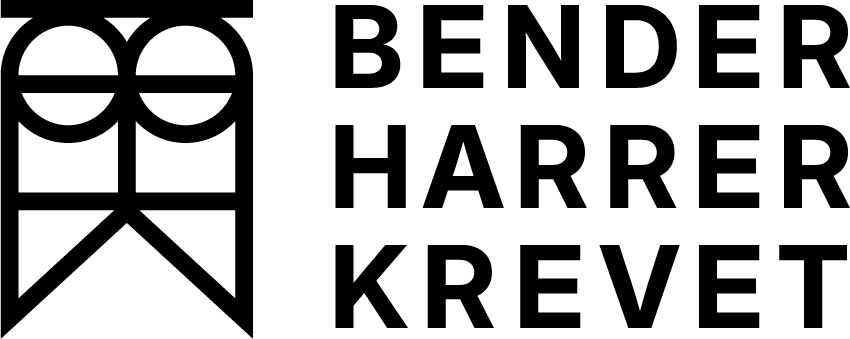
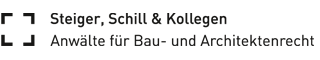
Schreibe einen Kommentar