 Wie nahezu jede neue Regierung haben sich auch CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, das Vergaberecht zu vereinfachen, beschleunigen und digitalisieren. Als Mittel für eine Beschleunigung haben die Neu-Koalitionäre unter anderem den vergaberechtlichen Rechtsschutz ausgewählt. Konkret soll die aufschiebende Wirkung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Vergabekammern zu den Oberlandesgerichten entfallen.
Wie nahezu jede neue Regierung haben sich auch CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, das Vergaberecht zu vereinfachen, beschleunigen und digitalisieren. Als Mittel für eine Beschleunigung haben die Neu-Koalitionäre unter anderem den vergaberechtlichen Rechtsschutz ausgewählt. Konkret soll die aufschiebende Wirkung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Vergabekammern zu den Oberlandesgerichten entfallen.
Die aufschiebende Wirkung – das Stoppschild für Vergabeverfahren
Bekanntlich wird ein Vergabeverfahren durch die Erteilung des Zuschlags an den obsiegenden Bieter beendet. Ein erteilter Zuschlag kann grundsätzlich nicht mehr aufgehoben werden. Mit Zuschlagserteilung haben andere Bieter somit keine Chance mehr auf den Auftrag. Um diese Chance zu wahren, tritt mit der Information des Auftraggebers über die Einreichung eines Nachprüfungsantrags ein Zuschlagsverbot ein. Dieses Zuschlagsverbot besteht grundsätzlich während des gesamten Verfahrens vor der Vergabekammer bis zum Ablauf der Beschwerdefrist. Da das Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer in der Regel in fünf, spätestens aber in sieben Wochen abgeschlossen sein soll, ist die durch das Zuschlagsverbot entstehende Verzögerung nach der Konzeption des Gesetzgebers begrenzt.
Anders ist es in der zweiten Instanz. Bis zur Entscheidung der Vergabesenate der Oberlandesgerichte vergehen meist mehrere Monate, teilweise auch über ein Jahr. Nach der bestehenden Rechtslage verlängert sich, auch wenn die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag abgelehnt hat, das Zuschlagsverbot mit Einreichung einer sofortigen Beschwerde zunächst um zwei Wochen (die sogenannte aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde). Die Vergabesenate können die aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die sofortige Beschwerde verlängern. In der Praxis erfolgt vielfach zunächst eine vorläufige Verlängerung für die Zeit, die der zuständige Senat für die inhaltliche Befassung mit und Entscheidung über den Verlängerungsantrag benötigt (sog. Hängebeschluss). Bislang geben die Vergabesenate Anträgen auf Verlängerung des Zuschlagsverbots überwiegend statt. So hatten im Jahr 2023 61,8 % der Anträge nach § 173 GWB Erfolg, wobei die Quote je nach Gericht sehr stark schwankte (siehe Vergabeblog.de vom 07/06/2023 Nr. 53595). In welchem Umfang die Unternehmen, die Anträge auf Verlängerung der aufschiebenden Wirkung gestellt haben, in der Hauptsache Erfolg hatten, lässt sich der Statistik nicht entnehmen. Mit Blick auf die Erfolgsquote sofortiger Beschwerden dürfte dieser Wert jedoch deutlich darunter gelegen haben.
Was die Politik plant
Bereits die Ampelregierung unter Olaf Scholz war der Auffassung, dass die Praxis der Vergabesenate Vergabeverfahren zu stark verzögere. Der Entwurf des Vergaberechtstransformationsgesetzes sah vor, dass die aufschiebende Wirkung nur noch in Ausnahmefällen verlängert werden kann. Der Ablauf der aufschiebenden Wirkung innerhalb von zwei Wochen nach Einreichung der Beschwerde sollte zum Regelfall werden.
Die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vorgesehene Regelung geht darüber noch hinaus: Die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde soll vollständig entfallen. Eine Interessenabwägung durch die Vergabesenate auf Grundlage einer summarischen Prüfung würde nicht mehr erfolgen. Hat die Vergabekammer einen Nachprüfungsantrag abgelehnt, soll der Auftraggeber somit den Zuschlag erteilen können, ohne die Entscheidung über die Beschwerde abwarten zu müssen.
Die Folge: Unternehmen könnten bei Ablehnung ihres Nachprüfungsantrags durch die Vergabekammer keinen gerichtlichen Rechtsschutz mehr in Anspruch nehmen, der ihnen die Chance auf den Zuschlag sichert (Primärrechtsschutz). Mit der sofortigen Beschwerde könnte lediglich die Feststellung erreicht werden, dass Unternehmen in ihren vergaberechtlichen Rechten verletzt sind. Auf dieser Grundlage müssten Unternehmen dann versuchen, Schadensersatz gegen den Auftraggeber geltend zu machen, und diesen ggf. auf dem Zivilrechtsweg einklagen (Sekundärrechtsschutz).
Sekundärrechtsschutz in Deutschland – (bislang) ein zahnloser Tiger
Hier beginnt das Problem: Schadensersatzansprüche stellen keine angemessene Kompensation für die Verlust der Chance auf den Zuschlag dar.
In Vergabeverfahren kommen zwei Kategorien von Schadensersatz in Betracht: Das negative und das positive Interesse. Mit dem negativen Interesse ist der Ersatz der Aufwendungen gemeint, die ein Unternehmen für die Erstellung des Teilnahmeantrags bzw. Angebots hatte. Ein auf das negative Interesse gerichteter Schadensersatz stellt das Unternehmen im besten Fall so, wie es gestanden hätte, wenn es sich nicht an der Ausschreibung beteiligt hätte. Ein Ausgleich für die verlorene Chance auf den Zuschlag ist damit nicht verbunden.
Weitergehende Kompensation bietet der auf das positive Interesse, also den Ersatz des entgangenen Gewinns aus dem Auftrag, gerichtete Schadensersatzanspruch. Ein derartiger Anspruch lässt sich jedoch in der Praxis so gut wie nie umsetzen. Grund dafür ist, dass nach dem deutschen Schadensersatzrecht der Bieter nachweisen muss, dass er ohne den Vergaberechtsverstoß den Zuschlag erhalten und damit einen entsprechenden Gewinn erzielt hätte. Gerade bei Vergaberechtsverstößen in einem frühen Stadium des Verfahrens, beispielsweise bei diskriminierenden Eignungs- oder Auswahlkriterien in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, ist ein solcher Nachweis aber nicht möglich. In der Konsequenz ist der vergaberechtliche Sekundärrechtsschutz derzeit in Deutschland so unattraktiv, dass er eher geringe praktische Relevanz hat. Aktuell bestreiten Bieter den Rechtsweg deshalb in der Regel nur so lange, wie sie noch eine Chance auf den Zuschlag haben.
Vorsichtigen Anlass zur Hoffnung gibt die EuGH-Entscheidung INGSTEEL aus dem Vorjahr. Darin hat der EuGH der Rechtsmittelrichtlinie eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten entnommen, Unternehmen für den Verlust der bloßen Chance auf den Zuschlag zu entschädigen, die – bei einem rechtskonformen Verhalten des Auftraggebers – mit der Teilnahme an einem Vergabeverfahren verbunden gewesen wäre (siehe EuGH, Urt. v. 06.06.2024, C-547/22, ECLI:EU:C:2024:478). In der Entscheidung hat sich der EuGH mit einer Praxis slowakischer Gerichte auseinandergesetzt, nach der für einen positiven Schadensersatz „sehr wahrscheinlich oder sogar nahezu sicher“ sein musste, dass „der Betroffene […] einen Gewinn erzielt hätte“. Der EuGH erachtete die Praxis als nicht mit der Rechtsmittelrichtlinie vereinbar. Obwohl damit auch der bisherige Umgang mit Schadensersatzansprüchen von Bietern in Deutschland großenteils unionsrechtswidrig sein dürfte, gibt es aktuell noch keine wesentlichen Änderungen beim (defizitären) Sekundärrechtsschutz in Deutschland.
Primärrechtsschutz durch die Vergabekammer reicht nicht aus
Damit stellt sich die Frage, ob nicht Primärrechtsschutz durch die Vergabekammern, der nach den Plänen der Koalition grundsätzlich erhalten bleiben soll, ausreichend ist.
Dabei ist aus rechtlicher Sicht Folgendes zu berücksichtigen: Die Vergabekammern sind zwar gerichtsähnlich aufgebaut, es handelt sich bei diesen aber anerkanntermaßen nicht um Gerichte (vgl. OLG München, Beschl. v. 11.06.2008, Verg 6/08, juris Rn. 9). Vergabekammern sind organisatorisch Einrichtungen innerhalb der Verwaltung (vgl. BGH, Beschl. v. 09.12.2003, X ZB 14/03, juris Rn. 18). Sie entscheiden dementsprechend durch Verwaltungsakt (§ 168 Abs. 3 GWB). Ihre Unabhängigkeit, die nach Art. 97 GG zentrales Merkmal eines Gerichts ist, ist zumindest zweifelhaft: Vergabekammern sind räumlich vielfach Teil der Behörden, bei denen sie gebildet werden. Sie werden regelmäßig auch durch diese Behörden besetzt (vgl. zum Ganzen Horn/Hofmann, in: Beck’scher Vergaberechtskommentar, 4. Aufl. 2022, § 157 GWB Rn. 17). Anders als bei einem Gericht, bei dem grundsätzlich nur Richter auf Lebenszeit tätig werden dürfen (§ 28 Ab. 1 DRiG), werden die Mitglieder der Kammer lediglich für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt (§ 157 Abs. 4 Satz 1 GWB).
Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Rechtsschutz durch Gerichte ist in einem Rechtsstaat ein hohes Gut. Gerichte und ihre Richter genießen besondere verfassungsrechtliche Garantien, wie beispielsweise die Unabhängigkeit. Diese dienen dazu, die Gewaltenteilung und insbesondere eine effektive Kontrolle der Verwaltung zu sichern. Der Rechtsschutz durch die Vergabekammern als Verwaltungsorganisationen kann daher den gerichtlichen Rechtsschutz nicht ersetzen.
Dies führt aus den nachfolgenden Gründen dazu, dass die im Koalitionsvertrag vorgesehene Abschaffung des gerichtlichen Primärrechtsschutzes unzulässig ist.
Vorgaben an den Primärrechtsschutz aus EU-Rechtsmittelrichtlinie und GPA
Auf europäischer Ebene regelt die sog. Rechtsmittelrichtlinie (RL 89/665/EWG) Anforderungen an die Kontrolle von Vergabeverfahren. Eine der Anforderungen ist, dass Unternehmen die Möglichkeit haben müssen, eine Entscheidung einer Nachprüfungsbehörde, die selbst kein Gericht ist, gerichtlich überprüfen zu lassen (Art. 2 Abs. 9). Eine solche gerichtliche Überprüfung muss dabei nicht zwingend erfolgen, bevor der Zuschlag erteilt wird (Art. 2 Abs. 4). Es reicht aus, wenn „eine gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber unabhängige Stelle in erster Instanz“ vor Zuschlagserteilung die Vergabeentscheidung kontrolliert (Art. 2 Abs. 3). Welche konkreten Anforderungen an diese unabhängige Nachprüfungsstelle bestehen, regelt die Rechtsmittelrichtlinie nicht.
Solche Vorgaben ergeben sich aber aus den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Europäischen Union und damit auch ihrer 27 Mitgliedstaaten aus dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement Agreement – GPA). Das GPA sieht in Art. 18 Abs. 6 verschiedene rechtsstaatliche Mindestanforderungen an Nachprüfungsinstanzen vor. Die Vergabekammern erfüllen diese Anforderungen derzeit nicht. Insbesondere fehlt es an dem Recht, eine öffentliche Verhandlung zu verlangen (Art. 18 Abs. 6 Buchst. e)). Einen entsprechenden Anspruch sieht das GWB nicht vor. In der Geschäftsordnung der Vergabekammern des Bundes ist dementsprechend geregelt, dass die Kammern aufgrund nicht-öffentlicher Verhandlung entscheiden. Die Folge ist, dass eine Möglichkeit bestehen muss, die Entscheidungen der Vergabekammern durch ein Gericht überprüfen zu lassen (Art. 18 Abs. 6). Dies gilt nach Art. 18 Abs. 7 Buchst. a) auch für „rasch greifende Übergangsmaßnahmen, damit der Anbieter unvermindert am Beschaffungsverfahren teilnehmen kann“ – also die Entscheidung über die Aufhebung des Zuschlagsverbots.
Nach den Vorgaben des GPA handelt es sich bei den Vergabekammern somit nicht um Nachprüfungsinstanzen, die abschließend über den Primärrechtsschutz entscheiden können. Vielmehr ist es erforderlich, dass ein Gericht die Entscheidung der Vergabekammer überprüft, noch bevor das Zuschlagsverbot wegfällt. Unter Berücksichtigung des GPA können Nachprüfungsbehörden, die – wie die Vergabekammern – dessen rechtsstaatliche Anforderungen nicht erfüllen, nicht als „unabhängige Stelle in erster Instanz“ im Sinne des Art. 2 Abs. 3 der Rechtmittelrichtlinie angesehen werden. Eine solche Stelle sind in Deutschland vielmehr erst die Vergabesenate der Oberlandesgerichte.
Deutschland hält daher seine Verpflichtungen aus der Rechtsmittelrichtline, ausgelegt unter Beachtung des GPA, nur ein, wenn weiterhin die Vergabesenate über das Fortbestehen des Zuschlagsverbot entscheiden. Sollte – wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist – die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde vor den Oberlandesgerichten vollständig entfallen, wären diese Anforderungen nicht mehr gewahrt.
Verfassungsrechtliche Anforderungen an den gerichtlichen Rechtsschutz
Zudem dürfte die geplante Abschaffung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde gegen Verfassungsrecht verstoßen.
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wurde es bislang unterschiedlich beurteilt, ob sich Unternehmen in Vergabeverfahren auf die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG (so ausdrücklich BVerfG, Beschl. v. 29.07.2004, 2 BvR 2248/03, NZBau 2004, 564 sowie indirekt Beschl. v. 23.04.2009, 1 BvR 3424/08, NZBau 2009, 464 Rn. 8) oder lediglich auf den allgemeinen Justizgewährleistungsanspruch berufen können (so für das Unterschwellenvergaberecht BVerfG, Beschl. v. 13.06.2006, 1 BvR 1160/03, NZBau 2006, 791). Da Unternehmen bei einer Verletzung in subjektiven Bieterrechten auch nach dem sogenannten allgemeinen Justizgewährleistungsanspruch grundsätzlich Primärrechtsschutz vor den Gerichten verlangen können, kann diese Frage vorliegend offen bleiben. Der allgemeine Justizgewährleistungsanspruch soll den Rechtsuchenden ebenfalls so weit wie möglich davor bewahren, dass durch die sofortige Vollziehung einer Maßnahme Tatsachen geschaffen werden, die – falls sich die Maßnahme als rechtswidrig erweist – nicht mehr rückgängig gemacht werden können (siehe BVerfG, Beschl. v. 13.06.2006, 1 BvR 1160/03, NZBau 2006, 791 Rn. 73).
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in der zuletzt genannten Entscheidung einen Anspruch auf Primärrechtsschutz für den Bereich des Unterschwellenvergaberechts verneint. Dies begründet das Gericht aber ausdrücklich damit, dass im Unterschwellebereich keine subjektiven Bieterrechte im Sinne des § 97 Abs. 6 GWB bestehen, sondern nur das allgemeine Gleichbehandlungsgebot aus Art. 3 GG. Auch handle es sich bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte um ein Massenphänomen, was eine Ungleichbehandlung von Vergaben oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte rechtfertige.
Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte scheint das BVerfG davon ausauszugehen, dass ein Primärrechtsschutz auch vor Gerichten bestehen muss. In einer Entscheidung aus dem Jahr 2004 heißt es:
„Das in den §§ 102 bis 129 GWB geregelte zweistufige Nachprüfungsverfahren dient dem vergaberechtlichen Primärrechtsschutz. Nur mit ihm kann der subjektive Anspruch des Bieters auf Einhaltung der Bestimmungen über das Vergabeverfahren durch den öffentlichen Auftraggeber während eines laufenden Vergabeverfahrens durchgesetzt werden“
(BVerfG, Beschl. v. 29.07.2004, 2 BvR 2248/03, juris Rn. 24).
Mit dem zweistufigen Nachprüfungsverfahren ist ausdrücklich auch der gerichtliche Rechtsschutz vor den Vergabesenaten gemeint.
Die Abschaffung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde ist zudem aus dem folgenden Grund verfassungsrechtlich bedenklich: Im Hinblick auf den gerichtlichen Rechtsschutz würden dadurch Bieter in oberschwelligen Vergabeverfahren schlechter gestellt als Bieter im Unterschwellenbereich. In Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte haben Unternehmen die Möglichkeit, vor den Zivilgerichten durch einen Antrag auf einstweilige Verfügung die Erteilung des Zuschlags zu verhindern. Diese Möglichkeit besteht bei Vergaben im Oberschwellenbereich aufgrund der Zuständigkeitskonzentration bei den Vergabekammern und -senaten gemäß § 156 Abs. 2 GWB nicht. Durch die Abschaffung des Primärrechtsschutzes vor den Vergabesenaten hätten Bieter in Vergabeverfahren oberhalb der Schwellenwerte somit weniger gerichtliche Rechtsschutzmöglichkeiten als unterhalb der Schwellenwerte. Eine solche Schlechterstellung wird der Bedeutung der Oberschwellenvergabe nicht gerecht. Sie lässt sich auch nicht dadurch rechtfertigen, dass im Oberschwellenbereich Primärrechtsschutz durch die Vergabekammern gewährt wird. Der Justizgewährleistungsanspruch zielt auf Rechtsschutz durch ein Gericht ab (vgl. zuletzt BVerfG, Beschl. v. 03.06.2022, 1 BvR 2103/16, juris Rn. 38). Wie bereits dargestellt sind Vergabekammern keine Gerichte und können diesen auch nicht gleichgestellt werden. Primärrechtschutz durch die Vergabekammern ist daher nicht ausreichend.
Geht es nicht auch anders?
To cut a long story short: Der geplante Wegfall des gerichtlichen Primärrechtsschutzes ist wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht unzulässig (siehe vertiefend zum Ganzen auch Schneider, Primärrechtsschutz nach Zuschlagserteilung bei einer Vergabe öffentlicher Aufträge).
Neben den aufgezeigten rechtlichen Bedenken sprechen eine Vielzahl (rechts-)politischer Gründe gegen die im Koalitionsvertrag vorgesehene Neuregelung. Vergaberechtliche Nachprüfungsverfahren üben einen weit über das jeweilige Verfahren hinausgehenden Kontrolldruck auf öffentliche Auftraggeber aus. Diese müssen sich auch deshalb vergaberechtskonform verhalten, weil ihre Handlungen einer möglichen Überprüfung durch die Vergabekammern und Oberlandesgerichte unterliegen. Die Einhaltung des Vergaberechts ist dabei kein Selbstzweck. Sie dient wettbewerblichen und transparenten Vergabeverfahren und sorgt für einen effizienten Umgang mit Steuergeldern. Wird der effektive Rechtsschutz nunmehr auf die Vergabekammern verkürzt, nimmt der Kontrolldruck ab. Im Zweifel hat dies nachteilige Folgen für den Wettbewerb und die effiziente Nutzung öffentlicher Mittel.
Aufgrund der begrenzten Effektivität des Sekundärrechtsschutzes dürften zudem viele Unternehmen bei einer ablehnenden Entscheidung der Vergabekammern zukünftig auf die Einlegung einer Beschwerde verzichten. Die Auslegung des Vergaberechts wäre dann weitgehend einer gerichtlichen Kontrolle entzogen. Dies ist im Hinblick auf die besondere Rolle des gerichtlichen Rechtsschutzes schon per se problematisch. Vergabekammern genießen nicht die gleiche Unabhängigkeit von der Verwaltung wie Gerichte. Hinzu kommt, dass ein Wegfall der Oberlandesgerichte als relevante vergaberechtliche Spruchkörper zu einer erheblichen Rechtszersplitterung führen würde. Überregional tätige Unternehmen wären damit noch deutlich stärker als bisher Rechtsunsicherheiten in Vergabeverfahren ausgesetzt.
Die Schwierigkeiten, die mit der Verzögerung der öffentlichen Beschaffung durch Beschwerdeverfahren verbunden sind, sind auch den Verfassern bekannt. Daher möchten sie sich abschließend mit einem konstruktiven Vorschlag an der Diskussion beteiligen. Die oftmals lange Dauer der Beschwerdeverfahren ist kein Naturgesetz, sondern hängt ganz maßgeblich mit der personellen Ausstattung der Vergabesenate zusammen. Im Jahr 2023 wurden bundesweit 119 Beschwerdeverfahren eingeleitet – eine durchaus überschaubare Zahl. Um diese Verfahren schneller zu bearbeiten, bräuchte es lediglich einer begrenzten Aufstockung personeller Mittel bei den Vergabesenaten. Dies gilt erst recht, wenn die vergaberechtlichen Beschwerdeverfahren bundesweit bei einem spezialisierten Senat gebündelt werden würden.
Ergänzend könnte erwogen werden, die Dauer der aufschiebenden Wirkung von bislang zwei Wochen auf einen Zeitraum zu verlängern, der es den Vergabesenaten realistischerweise ermöglicht, die erforderliche Interessenabwägung vorzunehmen (bspw. acht Wochen nach Einlegung der sofortigen Beschwerde). Dadurch würde es den Vergabesenaten erleichtert, vor Verlängerung der aufschiebenden Wirkung eine Entscheidung in der Sache zu treffen. Es wäre dann nicht mehr erforderlich, lediglich aufgrund des Zeitdrucks eine Entscheidung ohne (relevante) inhaltliche Prüfung zu treffen. Zugleich könnte durch die längere Frist die Praxis einer befristeten Verlängerung der aufschiebenden Wirkung mittels Hängebeschlusses bis zu einer abschließenden Entscheidung über den entsprechenden Antrag gesetzlich untersagt werden.
Für eng umgrenzte Ausnahmefälle ließe sich zudem im Rahmen der Abwägung das Interesse an der sofortigen Erteilung des Zuschlags gesetzlich besonders gewichtigen. Dies ist beispielsweise bereits bei bestimmten verteidigungs- und sicherheitsspezifischen Aufträgen der Fall (§ 173 Abs. 2 S. 2 und 3 GWB).
Um effektiven vergaberechtlichen Rechtsschutz für Unternehmen sicherzustellen, ist die Möglichkeit, die Vergabe vor Zuschlagserteilung durch ein Gericht überprüfen zu lassen, essenziell. Die vorstehenden Vorschläge zeigen, dass diese Möglichkeit beibehalten werden kann, ohne Vergabeverfahren übermäßig zu verzögern.
Nach dem Koalitionsvertrag soll in den nächsten vier Jahren in erheblichem Umfang in staatliche Infrastruktur und Verteidigung investiert werden. Im Vergleich zu den dafür vorgesehenen Mitteln fallen die erforderlichen Aufwendungen für eine angemessene Ausstattung der Vergabesenate nicht ins Gewicht. Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass eine Stärkung der Vergabesenate nicht nur der rechtskonformen Ausgestaltung des vergaberechtlichen Rechtsschutzes dient, sondern vor allem den ordnungsgemäßen Umgang mit den vielen Milliarden Euro sichert, die in den nächsten Jahren in die öffentliche Beschaffung fließen.
Kontribution
Dieser Beitrag wurde zusammen mit Frau Rechtsanwältin Ramona Ader verfasst.
Ramona Ader
Ramona Ader ist Rechtsanwältin in der Kanzlei BLOMSTEIN in Berlin und auf deutsches und europäisches Vergaberecht sowie EU-Beihilfe- und Zuwendungsrecht spezialisiert. Im Verga-berecht berät sie Bieter und öffentliche Auftraggeber in allen Phasen von Vergabeverfahren und begleitet diese in Nachprüfungsverfahren vor den Vergabenachprüfungsinstanzen.
Dr. Pascal Friton, LL.M.
Pascal Friton ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht. Er ist Partner der Kanzlei BLOMSTEIN in Berlin. Er berät seit über 10 Jahren sowohl öffentliche Auftraggeber als auch Bieter in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Who’s Who Legal führt ihn seit 2016 als einen der führenden Vergaberechtler weltweit. Er veröffentlicht regelmäßig in nationalen und internationalen Fachzeitschriften und hält Vorträge zu vergaberechtlichen Themen auf Konferenzen und Seminaren in Deutschland, Europa und den USA. Er wirkt darüber hinaus als Autor und Referent am Fernlehrgang “Public Procurement Regulation in the EU and in its Global Context” am King’s College London mit.




 (19 Bewertungen, durchschn.: 4,37aus 5)
(19 Bewertungen, durchschn.: 4,37aus 5)








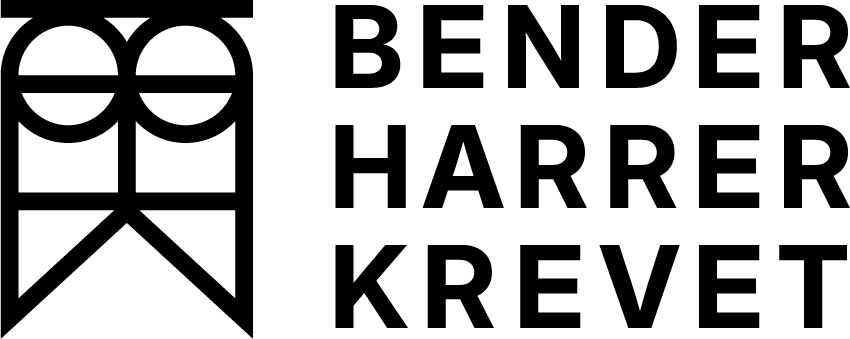

Schreibe einen Kommentar