
Im April 2025 hat die Björn Steiger Stiftung Verfassungsbeschwerde gegen den Bund und das Land Baden-Württemberg eingereicht. Ihr Vorwurf: Die staatliche Schutzpflicht in der Notfallversorgung werde verletzt – unter anderem wegen ineffizienter Strukturen und mangelnder Standards bei der öffentlichen Beschaffung. Veraltete Leitstellentechnik, langwierige Ausschreibungen und ein Flickenteppich aus lokalen Sonderwünschen behindern aus Sicht der Stiftung dringend nötige Innovationen.
Christof Chwojka ist Geschäftsführer im Bereich Rettungsdienst bei der Björn Steiger Stiftung. Im Interview spricht er über strukturelle Defizite in der Beschaffung, den Reformbedarf im föderalen System und die Hintergründe der Verfassungsbeschwerde.
DVNW: Die Björn Steiger Stiftung wirft in Ihrer vor kurzem vorgestellten Verfassungsbeschwerde dem Staat vor, seiner Schutzpflicht im Bereich der Notfallversorgung nicht ausreichend nachzukommen. Welche konkreten Mängel im System des Rettungsdienstes haben Sie zu diesem Schritt veranlasst?
Christof Chwojka: Deutschland hat in der Notfallversorgung massiv an Boden verloren. Der Rettungsdienst ist überlastet, weil andere Strukturen wie die hausärztliche Versorgung wegbrechen. Hochqualifizierte Notfallsanitäter dürfen oft nicht ihr Können einsetzen – ob jemand gerettet wird, ist häufig Zufall. Besonders problematisch: viele Leitstellen sind technisch schlecht ausgestattet und nutzen keine standardisierten Notrufabfragen. Auch bei der Digitalisierung hinkt Deutschland hinterher. Diese systemischen Mängel verletzen aus unserer Sicht das Grundgesetz – deshalb haben wir Verfassungsbeschwerde eingereicht.
DVNW: Sie haben es bereits angedeutet: Viele der Defizite im System hängen auch mit der Ausstattung der Leitstellen zusammen. Welche Rolle spielt dabei die öffentliche Beschaffung – etwa bei Technik, Software oder medizinischem Material?
Chwojka: Das Thema Beschaffung ist zentral. In vielen Leitstellen kommen Systeme zum Einsatz, die schon vor 15 Jahren veraltet waren. Innovative Lösungen, etwa cloudbasierte Systeme, wie sie international längst Standard sind, scheitern in Deutschland oft an den starren Beschaffungsprozessen. Startups haben kaum eine Chance, weil Ausschreibungen extrem komplex sind und häufig von Personen betreut werden, deren technisches Know-how nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Hinzu kommt: Die Innovationszyklen sind heute kurz – aber bis ein neues System beschafft und verbaut ist, vergehen oft sechs bis acht Jahre. In dieser Zeit ändert sich die Technik komplett. Die Folge sind teure, überdimensionierte Neubauten und Systeme, die bei ihrer Inbetriebnahme bereits veraltet sind. Ich bin ein großer Freund von transparenten Vergabeverfahren – aber wie sie aktuell aufgesetzt sind, behindern sie Innovation, gerade in einem so kritischen Bereich wie dem Rettungsdienst.
DVNW: Was müsste sich Ihrer Meinung nach strukturell im Vergabewesen ändern, damit Innovationen – etwa im Bereich der Leitstellentechnologie – schneller und wirksamer Einzug in den Rettungsdienst halten können?
Chwojka: Man sollte nur das ausschreiben, was wirklich nötig ist. Gerade im Bereich der Daseinsvorsorge erlaubt das EU-Recht in vielen Fällen Direktvergaben – Deutschland nutzt diese Möglichkeit aber kaum und macht unnötig komplizierte Ausschreibungen. Dazu kommen zu kurze Vertragslaufzeiten von drei bis fünf Jahren. Wer soll da in Qualität investieren, wenn unklar ist, ob man den Auftrag behält? Oft zählt nicht das beste, sondern das billigste Angebot – mit langfristig höheren Kosten und schlechterer Versorgung. Deutschland neigt dazu, für jede Lösung ein Problem zu finden, statt pragmatisch zu handeln. Wir brauchen mehr Mut zur Direktvergabe, längere Laufzeiten und ein Vergabeverständnis, das sich am Outcome orientiert – nicht nur am Preis.
DVNW: Welche Rolle spielt der Föderalismus bei der laut Ihnen oft ineffizienten Beschaffung im Rettungsdienst?
Chwojka: Der Föderalismus wird oft als Ausrede benutzt. Natürlich ist er nicht per se schlecht – aber in der Praxis führt er zu einem Flickenteppich. Ein Rettungswagen in Berlin unterscheidet sich technisch kaum von einem in Stuttgart – warum also nicht zentral beschaffen? Stattdessen dominiert vielerorts das Denken: „Wir wissen es besser als die anderen.“ Entscheidungen werden bis auf Landkreisebene zersplittert – jeder Ärztliche Leiter macht sein eigenes Ding. Das ist teuer, ineffizient und innovationsfeindlich. Statt mit gebündelter Marktmacht aufzutreten, wird kleinteilig ausgeschrieben – oft von Personen ohne Erfahrung. Innovation bleibt so auf der Strecke. Deutschland schafft es regelmäßig, europäische Regeln noch komplizierter zu machen – und wundert sich dann, warum es nicht funktioniert.
DVNW: Sie haben gerade beschrieben, wie ineffiziente Beschaffungsprozesse Innovation behindern und Geld verschwenden. Vor diesem Hintergrund: Wie groß ist aus Ihrer Sicht der aktuelle Investitionsbedarf im Rettungswesen – insbesondere bei Technik, Infrastruktur und Digitalisierung?
Chwojka: Der Investitionsbedarf im Rettungswesen ist erheblich – vor allem bei der Digitalisierung. Nur etwa 15 % der Prozesse sind digitalisiert, der Großteil läuft noch immer über Papier. Gleichzeitig wird viel Geld in überdimensionierte Projekte gesteckt, etwa Neubauten für Leitstellen im zweistelligen Millionenbereich. Allein für moderne IT und digitale Infrastruktur braucht es Milliarden. Doch Geld allein reicht nicht: Es fehlen zunehmend die Menschen – Notfallsanitäter, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte. Die Probleme lassen sich nicht mehr durch mehr Geld lösen, sondern nur durch ein grundlegendes Umdenken – mit besserer Patientensteuerung und klugem Ressourceneinsatz durch Digitalisierung.
DVNW: Wenn wir über die schleppende Digitalisierung sprechen – liegt das Ihrer Ansicht nach hauptsächlich an fehlenden finanziellen Mitteln, oder eher daran, dass die Beschaffungsprozesse für Software und Technik schlicht nicht funktionieren?
Chwojka: Es liegt nicht am Geld – es wird schlicht nicht richtig gemacht. Viele Verantwortliche haben nicht das nötige Know-how, und statt digitale Prozesse neu zu denken, versucht man, analoge Abläufe einfach in den Computer zu übertragen. Berater bringen oft veraltetes Wissen mit, zukunftsgerichtete Fragen – etwa zur Nutzung von Wearables oder smarter mobiler Technik – werden kaum gestellt, geschweige denn ausgeschrieben. So bleibt die Digitalisierung im Rettungswesen Stückwerk. Dabei geht es um enorme Summen: Der Gesundheitsbereich macht rund 30 % des Bundeshaushalts aus. Doch solange die Herangehensweise so rückwärtsgewandt bleibt, wird dieses Potenzial nicht genutzt.
DVNW: Welche konkreten Schritte müsste man denn konkret gehen, um die Beschaffung im Gesundheitswesen effizienter, moderner und innovationsfreundlicher zu gestalten?
Chwojka: Beschaffung könnte ein starker Innovationstreiber sein – wird aber oft falsch eingesetzt. Ausschreibungen sind häufig so gestaltet, dass kleine, innovative Anbieter gar nicht erst zum Zug kommen. Das verhindert neue Ideen schon im Ansatz. Gerade im Rettungswesen wäre es oft sinnvoller, gezielt zu beschaffen statt formal auszuschreiben – viele Verfahren sind unnötig kompliziert und führen am Bedarf vorbei. Zudem fehlt es an Innovationsbereitschaft: Statt moderne Lösungen zuzulassen, werden veraltete Systeme neu verpackt. Wer Veränderung will, muss offener denken – auch bei der Vergabe.
DVNW: Sie sprechen sich in Ihrer Verfassungsbeschwerde vor allem für einheitliche Standards aus – etwa beim Personal oder in der Versorgung. Wäre ein solcher Ansatz auch für die Beschaffung sinnvoll? Oder steht das nicht im Widerspruch zu Ihrer Forderung nach mehr Innovationsoffenheit und flexibleren Lösungen?
Chwojka: Wir fordern vor allem bundesweite Qualitätskriterien. Es geht nicht darum, lokale Innovationen zu blockieren, sondern darum, durch einheitliche Standards Vergleichbarkeit zu schaffen – auch in der Beschaffung. Wenn beispielsweise eine App zur Ersthelfer-Alarmierung ausgeschrieben wird, fehlen oft klare Anforderungen. Dann kann ein Anbieter mit 5.000 Euro genauso mitbieten wie einer mit fünf Millionen – das ergibt keinen Sinn. Deshalb braucht es Vorgaben vom Bund, damit Kommunen nicht länger auf eigene Spezifika bestehen. Diese Zersplitterung macht die Beschaffung teuer, ineffizient – und sie erschwert es Herstellern, passende Angebote zu machen. Ob unsere Verfassungsbeschwerde erfolgreich ist, ist ungewiss – die Hürden in Karlsruhe sind hoch. Aber schon das Einreichen hat Bewegung in die Debatte gebracht. Und das ist ein wichtiger Schritt.
DVNW: Erwarten Sie also weniger eine unmittelbare Reaktion des Bundes, sondern vielmehr Veränderungen auf kommunaler Ebene durch den Druck, den die Beschwerde entfalten könnte?
Chwojka: Genau. Vom Bund erwarten wir klare Rahmenvorgaben – aber die tatsächliche Veränderung muss vor Ort stattfinden. Die Kommunen müssten ihre Sonderwege endlich aufgeben. Gerade in der Beschaffung ist das ein großes Problem: Jeder will etwas anderes, und das treibt die Kosten – vor allem im europäischen Vergleich. Wir wissen, dass die Erfolgschancen vor dem Bundesverfassungsgericht gering sind. Aber uns geht es auch darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und die Diskussion anzustoßen. Und das ist uns bereits gelungen.





 (3 Bewertungen, durchschn.: 3,67aus 5)
(3 Bewertungen, durchschn.: 3,67aus 5)






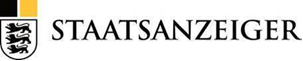
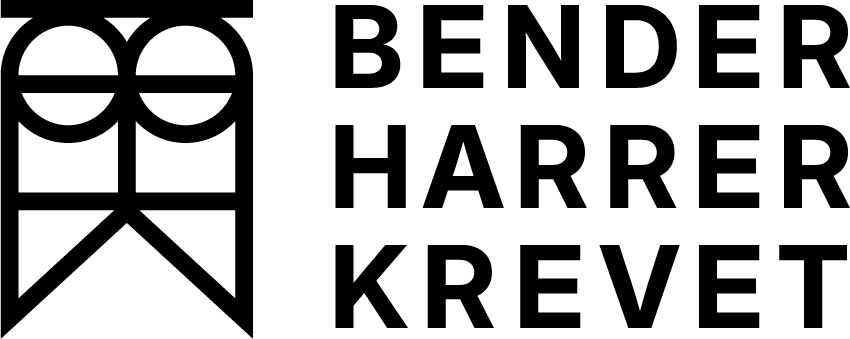
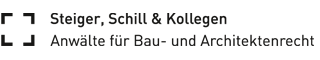
Schreibe einen Kommentar