Gemeinden haben bei der Vergabe von Stromkonzessionen das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot zu beachten.
Die Rechtsprechung leitet hieraus das Verbot der direkten Übernahme örtlicher Energieverteilernetze ohne vorherige Ausschreibung (Verbot direkter Aufgabenerledigung), das Verbot, bei der Ausschreibung des Betriebs örtlicher Energieverteilernetze den Betrieb durch eine kommunale Beteiligungsgesellschaft vorzugeben (Systementscheidungsverbot), sowie das Verbot, bei der Auswahl des Betreibers eines örtlichen Energieverteilernetzes spezifische kommunale Interessen zu berücksichtigen (Verbot der Berücksichtigung kommunaler Interessen) ab. Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass es sich bei dieser Rechtsprechung um in Anwendung bestehenden Gesetzesrechts entwickelte Grundsätze handelt, denen nicht die Qualität selbständiger Rechtsnormen zukommt. Deshalb können sie auch nicht im Wege der Kommunalverfassungsbeschwerde gerügt werden.
Sachverhalt:
Die Gemeinde Titisee-Neustadt hatte mit einem privaten Energienetzbetreiber einen Stromkonzessionsvertrag geschlossen, der zum 31. Dezember 2011 auslief. Um nach Auslaufen des Konzessionsvertrags das Stromnetz im Stadtgebiet selbst betreiben zu können, gründete die Beschwerdeführerin zusammen mit einem Partner eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gleichzeitig forderte die Beschwerdeführerin den privaten Energienetzbetreiber und einen Wettbewerber zur Abgabe eines abschließenden Angebots für die Stromkonzession auf. Am Ende entschied sich der Gemeinderat der Beschwerdeführerin dafür, den Konzessionsvertrag mit der neu gegründeten Gesellschaft abzuschließen. Nach einer Rüge des privaten Energienetzbetreibers leitete das Bundeskartellamt gegen die Beschwerdeführerin ein Verfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und einer Wettbewerbsbeschränkung ein. Daraufhin erhob die Beschwerdeführerin eine Kommunalverfassungsbeschwerde und beantragte die Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Verbots direkter Aufgabenerledigung, des Systementscheidungsverbots, sowie des Verbots der Berücksichtigung kommunaler Interessen, die aus Sicht der Beschwerdeführerin in der kartellrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck kommen.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen, da sie kein im Wege der Kommunalverfassungsbeschwerde rügefähiges Gesetz bezeichnet (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG, § 91 BVerfGG).
1. Beschwerdegegenstand der Kommunalverfassungsbeschwerde kann ein Gesetz des Bundes oder eines Landes sein (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG sowie § 91 Satz 1 BVerfGG). Gerichtliche Entscheidungen können im Verfahren der Kommunalverfassungsbeschwerde hingegen nicht dem Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung vorgelegt werden. Dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass die von ihr angegriffene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als Rechtsnorm anzusehen sei, die Außenwirkung gegenüber den Kommunen entfalte, kann nicht gefolgt werden. Auch höchstrichterliche Urteile sind kein Gesetzesrecht und erzeugen keine damit vergleichbare Rechtsbindung. Durch eine generelle Anerkennung der Rechtsnormqualität gerichtlicher Entscheidungen würde die vom Verfassungsgeber vorgenommene Beschränkung der Kommunalverfassungsbeschwerde auf Gesetze unterlaufen und die Kommunalverfassungsbeschwerde in eine Urteilsverfassungsbeschwerde umgewandelt. Die von der Beschwerdeführerin angegriffenen Urteile beruhen auf einer Auslegung von § 46 Energiewirtschaftsgesetz und wurden insofern in Anwendung bereits bestehenden Gesetzesrechts gefällt. Deswegen kommt ihnen die Qualität selbständiger, im Wege der Kommunalverfassungsbeschwerde rügefähiger Rechtsnormen nicht zu.
2. Durch die mangelnde Angreifbarkeit gerichtlicher Urteile im Rahmen der Kommunalverfassungsbeschwerde entstehen auch keine Rechtsschutzlücken. Denn zum einen sind die Fachgerichte dazu aufgerufen, in den ihnen zur Entscheidung vorgelegten Verfahren auch der besonderen Bedeutung der den Gemeinden gewährleisteten Garantie der kommunalen Selbstverwaltung Rechnung zu tragen. Zum anderen besteht in Fällen, in denen sich die Fachgerichte an eine verfassungsrechtliche Vorgaben nicht hinreichend berücksichtigende Gesetzeslage gebunden sehen, nach Art. 100 Abs. 1 GG die Verpflichtung, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen.
Quelle: Bundesverfassungsgericht












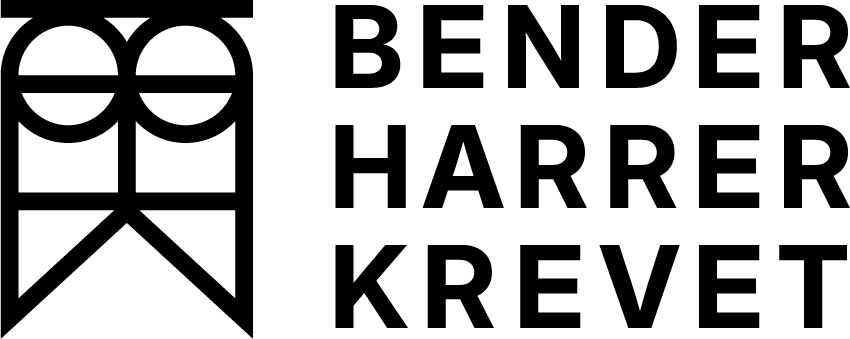

Schreibe einen Kommentar