
Dr. Jan Redmann war lange Zeit als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB tätig. Neben Bauvertragsrecht lag sein Schwerpunkt auch im Bereich des Öffentlichen Rechts und dem Vergaberecht. Nun sitzt er als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag. Vor wenigen Wochen kündigte Redmann an, die Oppositionsfraktion werde einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Landesvergabegesetzes einbringen. Wir haben mit dem Politiker in seinem Büro in Brandenburger Landtag in Potsdam über die Forderungen seiner Partei, seine Erfahrungen aus der juristischen Praxis und die Zukunft des Vergaberechts gesprochen.
DVNW: Herr Dr. Redmann, Sie waren lange Zeit als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, unter anderem mit Bezug zum Vergaberecht, tätig. Was hat sie dazu gebracht, hauptberuflich in die Politik zu wechseln?
Dr. Jan Redmann: Der Politik bin ich schon ein bisschen länger verbunden als dem Vergaberecht. Ich bin Brandenburger und war an meinem Gymnasium bereits Schülersprecher. Es war eigentlich auch eher die Bildungspolitik und das Defizit, das es im Brandenburger Bildungssystem gibt, das mich zur Politik gebracht hat. In meiner beruflichen Laufbahn ist mir dann das Vergaberecht untergekommen. Zu diesem Zeitpunkt waren die neuen Landesvergabegesetze in fast allen Bundesländern ein großes Thema – so auch in Brandenburg. Je näher ich mich dann fachlich damit beschäftigt habe – sowohl aus der anwaltlichen Sicht als auch aus der Sicht eines Seminarleiters zum Thema Vergabe – desto mehr ist mir bewusst geworden, wie wenig Wirkung diese Regelungen eigentlich entfalten. Wie viel da nur politische Symbolik dahinter steckt und vor allen Dingen wie viel Aufwand, Bürokratie und am Ende auch Frustration wegen der Anwendungsprobleme damit verbunden sind.
DVNW: Wie sehr begleitet Sie das Thema Vergaberecht denn auch heute noch?
Dr. Redmann: Das Thema ist ja nicht vom Tisch. Die Landesvergabegesetze sind wie ein Wahlkampfmurmeltier. Sie kommen immer pünktlich zu den Wahlkämpfen wieder auf die Tagesordnung, weil damit insbesondere aus dem eher mitte-linkspolitischen Spektrum der Eindruck erweckt wird, man könnte allen Arbeitnehmern übers Landesvergaberecht mehr Geld zahlen. Das ist Bauernfang, der damit betrieben wird. Ganz pünktlich zu jedem Wahlkampf kommt in Brandenburg und auch in anderen Ländern zum Beispiel die SPD mit einem höheren Vergabemindestlohn. Das Wort „Vergabe“ wird meist weg genuschelt und es wird der Eindruck erweckt, man könnte in Brandenburg einen allgemein höheren Mindestlohn erreichen. Dann wird oft noch die Tariftreue mit reingemischt, die irgendwie den Eindruck erwecken soll, alle würden jetzt durch das Vergaberecht unter Tarifverträge fallen. Es wird im Wahlkampf also eine Wirksamkeit des Landesgesetzgebers behauptet, die so rechtlich überhaupt nicht existiert und die am Ende bei den Wählern dieser Parteien auch eigentlich nur für Enttäuschung sorgen wird. Ich persönlich empfinde es einfach als unseriös, auf diese Weise Politik zu machen.
DVNW: Sie haben erst kürzlich öffentlich gefordert, das Landesvergaberecht in Brandenburg abzuschaffen. Was sind die Hauptgründe für diese Forderung?
Dr. Redmann: Ich glaube, dass man in der Politik häufiger auch darüber nachdenken sollten, Dinge abzuschaffen, die sich irgendwie etabliert haben, bei denen aber keiner mehr so richtig gut begründen kann, warum es sie noch gibt. Und dann einfach mal zu schauen, ob uns was fehlt. Wir haben in Deutschland Bundesländer wie Bayern, die bis heute kein Landesvergaberecht haben. Das Vergaberecht ist im Wesentlichen durch Vorschriften der Europäischen Union, aber auch durch nationale Umsetzungsnormen wie die Vergabeverordnung kodifiziert. Das, was auf Landesebene darüber hinausgeht ist reine Symbolik. Wenn wir uns das in Brandenburg ansehen: Hier hat das Landesvergabegesetz möglicherweise durchaus mal seine Bedeutung gehabt. Beispielsweise durch den Vergabemindestlohn, als es in Deutschland noch keinen allgemeinen Mindestlohn gab. Da hätte der Wettbewerb um den besten Preis dazu beitragen können, dass man am Ende Niedriglohnbeschäftigungen befördert und Lohn-Dumping betreibt. Inzwischen haben wir aber einen allgemeinen Mindestlohn in Deutschland. Wenn wir uns das dann mal historisch ansehen, dann liegt der Vergabemindestlohn in Brandenburg über weite Strecken dieser Parallelität nur wenige Cent über dem allgemeinen Mindestlohn. Das ist also nichts, was in irgendeiner Weise eine soziale Auswirkung auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat. Am Ende ist es wirklich nur ein Thema, weil man es auf Wahlplakate drucken will.
DVNW: Die Regierungskoalition in Brandenburg hat in ihrem Koalitionsvertrag durchaus bereits Punkte angesprochen, die das Vergaberecht verbessern sollen. Darunter unter anderem eine Anhebung der Wertgrenzen für Direktvergaben und das Versprechen des Bürokratieabbaus. Warum reichen Ihnen die Vorhaben der Landesregierung nicht aus?
Dr. Redmann: Das Problem ist, dass sie zusätzlich im Koalitionsvertrag ja auch noch weitere bürokratische Vorschriften vereinbart haben, insbesondere die Tariftreue. Wir sehen es in Berlin: Das Ganze führt am Ende zu einer Fortsetzung der Zweiteilung des Angebotsmarktes. In Brandenburg sind mehr als 98 Prozent der Unternehmen KMUs. Sie sind in der Regel nicht tarifgebunden. Viele von ihnen bewerben sich aber auch jetzt schon gar nicht mehr um öffentliche Aufträge, weil sie den bürokratischen Aufwand scheuen. Wenn wir diese Tariftreue-Regelung einführen, dann nimmt die Diskriminierung der Brandenburger Unternehmenslandschaft zu. Ich befürchte, dass dadurch am Ende weniger öffentliche Aufträge in Brandenburg landen. Wozu dieses Gesetz aber nicht führt, ist, dass tatsächlich mehr Geld beim Arbeitnehmer ankommt. Wir sehen anhand von Berlin außerdem den riesigen Aufwand: Sich aus den verschiedenen Tarifverträgen rauszusuchen, welchen Stundenlohn ich für welche Leistung zahlen muss, ist unglaublich kompliziert. Diesen Aufwand betreibt am Ende auch keiner. Mein Eindruck aus der Praxis ist, dass die meisten einfach nur ihre Unterschrift unter die erforderten Dokumente setzen. Es wird nichts kontrolliert. Für den allgemeinen Mindestlohn haben wir den Zoll, der das auch wirklich überprüft. Es gibt Durchsuchungen, es gibt Kontrollen auf den Baustellen und so weiter. All das findet im Vergaberecht überhaupt nicht statt. Die Tariftreue ist hier ein reiner Papiertiger. Letzten Endes hat das keine Auswirkung auf die Praxis. Es reicht deutschlandweit das, was national kodifiziert ist.
DVNW: Wo genau läge denn der Vorteil im Falle einer Abschaffung des Landesvergaberechts – für die öffentliche Verwaltung auf der einen und für die Unternehmen in Brandenburg auf der anderen Seite?
Dr. Redmann: Zunächst einmal gäbe es weniger Bürokratie bei der Auftragsvergabe. Die Anzahl der Formulare wird kleiner. Es muss weniger hin und her bestätigt und es müssen weniger Nachweise geführt werden. Insbesondere diejenigen, die das noch ernst nehmen, hätten weniger Aufwand, was ihre eigenen Lohnbuchhaltungen angeht. Wir reden hier zum Beispiel über Centbeträge, in denen sich der allgemeine Mindestlohn vom Vergabemindestlohn unterscheidet. Das sind alles Bereiche, in denen wir die Unternehmen entlasten würden. Wir würden aber auch die Kommunen entlasten. Wir haben in Brandenburg mit Blick auf die Amtsverwaltungen zum Teil nicht sehr leistungsfähige Kommunen. Die Amtsverwaltungen haben nur 30-40 Mitarbeiter für all die Aufgaben, die auf kommunaler Ebene zu erledigen sind, manche sogar noch weniger. Da muss in manchen Fällen eine einzige Person in der Lage sein, die Vergaben zu administrieren. Das ist für die eine riesige Herausforderung. Zumal dort es wenige Volljuristen gibt, die dafür zuständig sind. Das ist dann oft eine Aufgabe, die einem Sachbearbeiter aufs Auge gedrückt wird und der damit komplett überfordert ist. Denen die Arbeit etwas leichter zu machen, mit dem, was bei uns in unserer Hoheit als Landesgesetzgeber liegt, das sehe ich als sinnvoll und notwendig an. Zumindest, und das ist ja der Bereich, über den wir reden, unterhalb der europäischen Vergaben. Ich weiß, die Anforderungen, sobald wir über die Schwellenwerte kommen und wir europaweit ausschreiben müssen, die sind anspruchsvoll. Das sind dann aber auch Größenordnungen, in denen es Sinn macht, auf einen fairen Wettbewerb zu achten. Das Landesvergaberecht ist aber insbesondere dort ein Bürokratietreiber, wo die Auftragswerte relativ klein sind. Wenn also in den Kommunen zum Beispiel mal ein fünfstelliger Bauauftrag vergeben wird. Gerade dort diese zusätzlichen bürokratischen Auflagen zu verhängen – damit ist keinem geholfen. Weder den Unternehmen noch den Kommunen.
DVNW: Auch auf Bundesebene wurde im letzten Jahr immer mal wieder über das Vergaberecht diskutiert. Das sogenannte Vergabetransformationsgesetz ist zwar vorerst gescheitert, bei einem möglichen Tariftreuegesetz wird es hingegen schon etwas konkreter. Wie sehen Sie die derzeitigen bundespolitischen Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Beschaffung?
Dr. Redmann: Ich habe den Eindruck, dass diese Initiativen aus einer anderen Zeit kommen. Wir haben auch auf der Bundesebene keinen Anlass, über zusätzliche Bürokratie nachzudenken. Das Vergaberecht hat genau zwei Ziele: Dass erstens die öffentliche Hand wirtschaftlich beschafft und zweitens der Wettbewerb fair abläuft. Dafür ist das Vergaberecht ursprünglich erfunden worden und dafür gibt es das auch auf europäischer Ebene. Alles, was darüber hinausgeht, beispielsweise auch Umweltanforderungen, die stellen sich doch spätestens mit kommenden EU- Vorgaben zur Taxonomie und der CSRD genauso, wenn ein privates Unternehmen beschafft. Ich blähe das Vergaberecht immer dann auf, wenn ich an die öffentliche Hand in Bereichen, die eigentlich nichts mit wirtschaftlicher Beschaffung zu tun haben, zusätzliche Anforderungen stelle. Zum Beispiel wenn ich fordere, dass die öffentliche Hand umweltfreundlicher oder sozialer beschaffen muss als alle anderen. Ich entwickle dadurch Stück für Stück durch die Hintertür eine zweite Gesetzgebungs- und Normenebene, die nur für die öffentliche Hand gilt und alles nur doppelt kompliziert macht. Wir haben doch hohe Umweltstandards in Deutschland. Wir haben auch Standards, was die Einsparung von CO2 angeht. Wir haben soziale Standards in Deutschland, die für alle gleichermaßen gelten. Wenn wir für die öffentliche Beschaffung höhere Anforderungen definieren, dann führen wir auch doppelte Bürokratie ein. Insofern plädiere ich sehr dafür, es beim Vergaberecht bei dem zu belassen, was das Vergaberecht im Kern ausmacht: Die Garantie des fairen Wettbewerbs und der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Beschaffung.
DVNW: Mit Blick auf die von Ihnen erwähnten höheren Anforderungen an öffentliche Aufträge im Vergleich zur Privatwirtschaft könnte man argumentieren, dass der Staat durch seine Vergabepraxis eine Vorbildfunktion übernimmt und nachhaltige sowie soziale Kriterien gezielt fördern sollte. Kritiker warnen zudem, dass derartige Aspekte ohne eine klare rechtliche Verankerung im Vergaberecht vernachlässigt werden würden. Wie bewerten Sie diese Sichtweise?
Dr. Redmann: Das Problem an beispielsweise den Landesvergabegesetzen ist, dass man dann sehr abstrakt für alle Auftragsvergaben Vorschriften definiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel eine Kommune im Einzelfall für ein bestimmtes Projekt besonders ökologisch beschaffen will. Das ist auch in Ordnung, das kann sie auch. Jeder Auftraggeber kann seine eigenen Kriterien definieren und neben den reinen ökonomischen auch qualitative Kriterien festlegen. Diese Möglichkeit soll auch jeder Auftraggeber weiterhin haben. Was mich stört, sind diese pauschalen Bevormundungen gegenüber den Auftraggebern. Die Situationen in den Kommunen sind einfach sehr unterschiedlich. Für manche ist an einer bestimmten Stelle ein ökologischer Standard besonders wichtig. In anderen Fällen wird kein höherer sozialer Standard benötigt, weil es in diesem Bereich durch allgemein verbindliche Tarifverträge gar kein Problem mit niedrigen Löhnen gibt. Diese Landesvergabegesetze nehmen den Kommunen einen Teil ihrer kommunalen Selbstverwaltung und ihrer Entscheidungsfreiheit, welche Kriterien sie für besonders wichtig halten und wofür sie auch bereit sind dann am Ende mehr Geld auszugeben. Im Brandenburger Landesvergabegesetz ist festgelegt, dass die Kommunen für den Mehraufwand, der mit diesem Landesvergabegesetz verbunden ist, pauschal eine Million im Jahr erhalten. Das sind eine Million an Steuergeldern, die da verteilt werden, nur um den Mehraufwand in den Kommunen zu subventionieren, ohne dass es überhaupt notwendig wäre oder Effekte erreicht werden, die bei den Menschen vor Ort ankommen. Das ist alles sehr nebulös und am Ende bleibt es bei einem effektlosen Papiertiger. Und das liegt daran, dass es so abstrakt ist. Dass ich für alle Aufträge, obwohl sie so unterschiedlich sind, diese Vorgaben definiere. Mit all den Nachweispflichten, den verschiedenen Belegen, den besonderen Verabredungen und den Zusicherungen. All das führt am Ende aber nicht zu besseren Ergebnissen.
DVNW: Die FDP redet bei diesen, meist ökologischen oder sozialen, Standards oft von „vergabefremden Kriterien“. Sie haben selbst praktische Erfahrungen gesammelt – wie haben Sie diese Regelungen in ihrem Berufsalltag als Fachanwalt erlebt? Empfinden sie diese Formulierung der Freien Demokraten als zutreffend?
Dr. Redmann: Das ist ein zutreffender Fachbegriff, ja. Vergabefremd deshalb, weil der Sinn und Zweck des Vergaberechts die wirtschaftliche Beschaffung und der faire Wettbewerb sind. Alles andere sind zusätzliche Bedingungen. Ob das jetzt ILO-Kernarbeitsnormen oder Fragen des Nachweises für bestimmte Herstellungsarten in anderen Ländern sind – es geht hierbei oft nur um Zertifizierungen. Damit ist erneut ein Mehraufwand verbunden. Am Ende steht dann ein Siegel, das mehr oder weniger belastbar ist und nur dazu dient, eine bestimmte Nachweispflicht zu erfüllen. Das ist vergabefremd, weil es eigentlich im System des Vergaberechtes nicht angelegt ist. Man lädt die Auftragsbeziehung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber durch diese vergabefremden Kriterien und dieser sogenannten Vorbildfunktion politisch auf. Aber weder der Auftraggeber noch der Auftragnehmer können dem eigentlich wirklich gerecht werden. Und was folgt daraus? In aller Regel weichen alle diesem politischen Anspruch dadurch aus, dass sie eine Aktenlage schaffen, die alle irgendwie zufrieden stellt. Dann bestätigen sich alle gegenseitig alles Mögliche, in Wirklichkeit wird aber überhaupt nicht kontrolliert, ob die Kommune oder der Auftragnehmer dieser erwarteten Vorbildfunktion eigentlich gerecht werden. Am Ende gibt es kein Ergebnis außer sehr viel geschriebenes Papier.
DVNW: Basierend aus ihrer eigenen juristischen Erfahrung – welche Stellschrauben müssen gedreht werden, um das Vergaberecht praxisnäher zu gestalten?
Dr. Redmann: Wir müssen uns wieder auf den eigentlichen Kern des Vergaberechts konzentrieren, nämlich die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs und die wirtschaftliche Beschaffung. Und wir sollten den Kommunen dabei helfen, mutiger zu sein, wenn es um die die Festlegung eigener auftragsbezogener qualitativer Kriterien angeht. Wenn eine Kommune Fahrzeuge beschafft, wird nach meinem Dafürhalten in der Gegenwart zu oft einfach nur auf den Kaufpreis eines Fahrzeugs geschaut. Man beschäftigt sich zu wenig damit, welche Kosten das Fahrzeug eigentlich im Laufe seiner Lebenszeit noch so verursacht. Da fallen dann zum Beispiel auch Kraftstoffkosten mit rein. In diesem Falle würde sich ein ökologischeres Fahrzeug auch am Ende auch als das wirtschaftlichere Fahrzeug darstellen. Die Kommunen und die Vergabestellen zu ermutigen, diese Faktoren in der Vergabe zu verwirklichen, wäre dann auch nicht die Berücksichtigung eines vergabefremden Kriteriums. Zu sagen „habt die Wirtschaftlichkeit eures Produkts im Blick, nicht nur bei den Kaufkosten, sondern auch bei den Kosten des Lebenszyklus“ – das fiele dann unter vergabeeigene Kriterien. Am Ende hätten alle was davon. Die Kommunen hätten unterm Strich über die Lebenszeit ein wirtschaftlicheres Produkt. Und der Markt würde sich zu diesem Thema mehr Gedanken machen. Und das alles ohne überbordende Bürokratie. Kommunen haben schon heute diese Möglichkeiten – sie werden nur zu wenig genutzt. Denn natürlich ist es leichter, einfach nur die Angebotspreise zu vergleichen. Dadurch ist eine Vergabe auch weniger angreifbar. Viele Sachbearbeiter trauen sich nicht, zusätzliche qualitative Kriterien zu definieren.
DVNW: Wenn Sie zum Schluss auf ihre Erfahrung sowohl als Politiker als auch als Anwalt zurückblicken: Was ist der dringendste Appell an die zukünftige Bundesregierung bezüglich des Vergaberechts, der sich daraus ergibt?
Dr. Redmann: Wir sollten im Vergaberecht darauf achten, dass wir es nicht noch komplizierter machen, als es durch EU-Vorschriften bereits ist. Das hat auch was mit einem fairen Wettbewerb innerhalb Europas zu tun. Es ist wahrscheinlich für manche Politiker allzu verlockend, die Diskussion um das Vergaberecht mit anderen politischen, also vergabefremden Themen aufzuladen. Genau dieses Aufladen zu unterlassen wäre mein dringendster Wunsch an die nächste Bundesregierung. Ich freue mich, dass die jetzige Bundesregierung mit vielen vergaberechtlichen Vorschriften nicht mehr zu Ende gekommen ist. Dass die also nicht mehr im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden und deshalb auch keine Wirkung mehr entfalten. Wäre das geschehen, hätte das massive zusätzliche Bürokratie verursacht. Noch viel mehr als das, über was wir hier auf landesrechtlicher Ebene sprechen. Es braucht ein möglichst schlankes Vergaberecht auf Bundesebene, das für alle gleichermaßen gilt. Und dann weniger beziehungsweise gar keine zusätzlichen Anforderungen auf der Landesebene. Das würde tatsächlich für weniger Bürokratie sorgen. Und davon würden alle profitieren. Denn letztlich hat auch jeder Steuerzahler etwas davon, wenn sein Steuergeld nicht dafür ausgegeben wird, um möglichst viel Verwaltung zu unterhalten – sondern um tatsächlich Produkte für die öffentliche Hand zu schaffen. Dann haben wir auch mehr Geld zur Verfügung, um Schulen zu bauen oder Polizeiwachen besser auszustatten.


 (9 Bewertungen, durchschn.: 4,33aus 5)
(9 Bewertungen, durchschn.: 4,33aus 5)








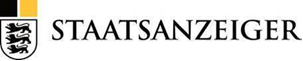
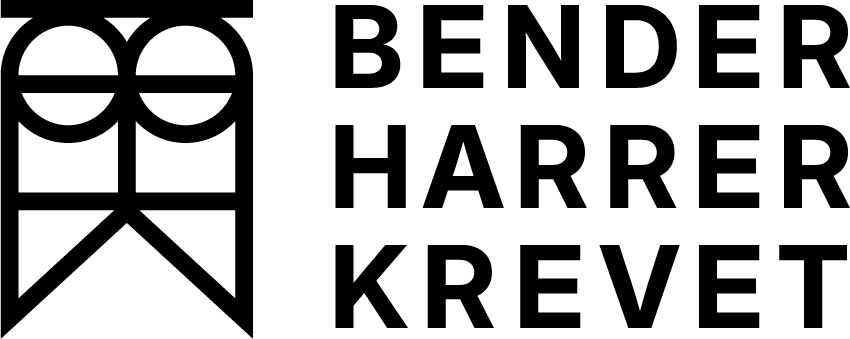
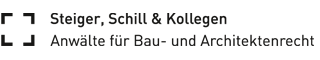
Schreibe einen Kommentar