
Am 16. Dezember 2024 haben 394 der 717 im Bundestag anwesenden Abgeordneten in einer historischen Abstimmung dem (noch) Bundeskanzler Olaf Scholz ihr Vertrauen entzogen. Der Weg für vorgezogene Neuwahlen ist nun offiziell frei. Mit dem Termin am 23. Februar bleibt jedoch nur wenig Zeit für Wahlkampf – und dementsprechend nur wenig Zeit, um sich als Wähler:in zu entscheiden. Um Ihnen bei all der Informationsflut einen Überblick zu verschaffen, haben wir in unserer exklusiven Artikel-Serie, dem Vergabeblog Bundestagswahl-Guide, zusammengefasst, was die jeweiligen Parteien in Bezug auf das Vergaberecht und die öffentliche Beschaffung geplant haben.
Bündnis 90/Die Grünen haben in ihrem Regierungsprogramm 2025 umfassende Reformen im Bereich der öffentlichen Beschaffung und des Vergaberechts angekündigt. Wir haben uns das Programm durchgelesen und die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst.
- Modernisierung des Vergaberechts: Das Vergaberecht wird umfassend modernisiert, um nachhaltige Beschaffung zu vereinfachen und zur Regel zu machen. Dabei sollen Vergabestellen, insbesondere Kommunen, und die Wirtschaft um über eine Milliarde Euro an Verwaltungskosten entlastet werden. Auch soll die Digitalisierung der öffentlichen Vergabe vorangetrieben werden, um Verfahren effizienter und transparenter zu gestalten. Hierfür werden IT-Budgets zentralisiert und einheitlich gesteuert.
- Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung: Regionale Produkte und die Resilienz der europäischen Wirtschaft sollen als Vergabekriterien stärker berücksichtigt werden. Öffentliche Beschaffung soll nachhaltiger gestaltet und durch geeignete Hilfsinstrumente für Vergabestellen erleichtert werden.
- Förderung von KMU und Start-ups: Die Losvergabe bleibt der Regelfall, damit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besseren Zugang zu öffentlichen Aufträgen erhalten. Gleichzeitig wird die Direktauftragsgrenze erhöht. Auch Start-ups sollen künftig stärker bei der Vergabe berücksichtigt werden.
- Praxis- und Digitalcheck: Durch einen Praxis- und Digitalcheck werden Gesetzesvorhaben darauf geprüft, ob sie digital umsetzbar und praxistauglich sind. Dadurch sollen unnötige bürokratische Hürden reduziert werden.
- Open Source und digitale Dienste: Die Nutzung von Open-Source-Technologien wird gefördert, um Abhängigkeiten von proprietärer Software zu reduzieren.
- Europäische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich: Die europäische Zusammenarbeit in der Rüstungsbeschaffung wird ausgebaut, um ineffiziente Doppelstrukturen zu vermeiden. Eine gemeinsame Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern soll gefördert werden.
- Soziale Kriterien und Tariftreue bei Vergaben: Öffentliche Aufträge des Bundes sollen bevorzugt an Unternehmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen. Soziale Kriterien sollen auch bei großvolumigen Fördermitteln eine Rolle spielen, ohne dass unnötige Bürokratie entsteht.
- Öffentliche Investitionen für Klimaneutralität: Die öffentliche Vergabe soll verstärkt zur Förderung klimaneutraler Produkte beitragen. In Sektoren wie Stahl und Zement werden Mindestquoten für grüne Produkte eingeführt. Der CO₂-Preis wird als wirtschaftlicher Anreiz genutzt, um klimaneutrale Produkte attraktiver zu machen.
- Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft: Mit digitalen Gebäudepässen für öffentliche Gebäude soll die Wiederverwendung von Baumaterialien erleichtert werden.
- Stärkung der kommunalen Vergabe: Kommunen sollen mehr Handlungsspielraum in der öffentlichen Beschaffung erhalten. Direkte Finanzierungszuschüsse ersetzen komplizierte Förderprogramme.
- Rückführung kommunaler Daseinsvorsorge-Unternehmen: Kommunen werden dabei unterstützt, Unternehmen der Daseinsvorsorge wieder in öffentliche Hand zu bringen.











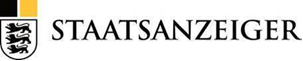
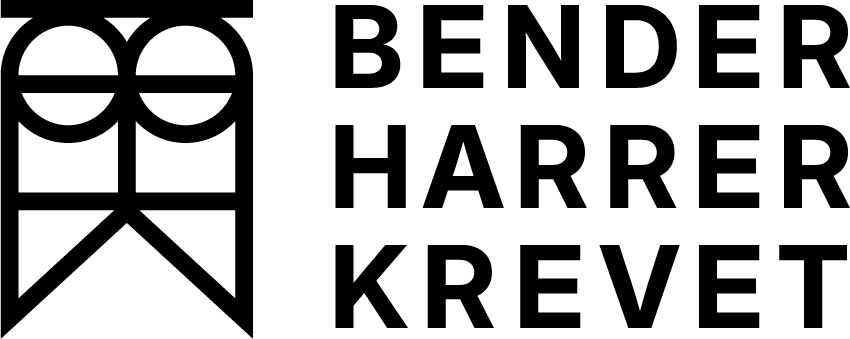
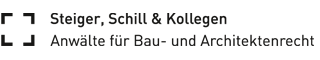
Schreibe einen Kommentar