
Die Wochen nach der Bundestagswahl 2025 standen ganz im Zeichen der Debatte um das von CDU und SPD geplante Sondervermögen und die dafür erforderliche Änderung der Schuldenbremse. Nach langem Ringen ist nun der Weg frei: Der Bundesrat hat dem milliardenschweren Finanzpaket zugestimmt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Grundgesetzänderung unterzeichnet. Was bedeutet das für die öffentliche Beschaffung? Verbände sowie Expertinnen und Experten reagieren unterschiedlich – zwischen Aufbruchsstimmung, grundsätzlicher Kritik und konkreten Reformforderungen. Eine Übersicht.
Mit der Zustimmung des Bundesrates und der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten ist der Weg für das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen nun endgültig geebnet. In der öffentlichen Beschaffungsbranche sorgt das neue Finanzpaket für gemischte Reaktionen. Während viele Akteure die zusätzlichen Mittel als dringend nötigen Impuls für Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz bewerten, mahnen andere zu einer klugen und strategisch ausgerichteten Mittelverwendung. Die Erwartungen sind hoch – ebenso wie die Forderungen an Politik und Verwaltung.
Verhaltener Optimismus in der Baubranche
Die Baubranche begrüßt das Sondervermögen grundsätzlich als notwendigen Schritt, um die überfällige Modernisierung der Infrastruktur in Deutschland voranzubringen. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, beschreibt das Finanzpaket als wegweisend und unerlässlich, verweist jedoch auch auf zentrale Voraussetzungen, damit die bereitgestellten Mittel auch effektiv eingesetzt werden können. Gegenüber dem Vergabeblog ordnet er ein:
„Die Öffentlichen Auftraggeber müssen in die Lage versetzt werden, die zusätzlichen Projekte, die jetzt an den Markt kommen, auch bewältigen zu können: Das bisherige Klein-Klein, die unzähligen Planungsschritte, ein Vergaberecht, das in Fach und Teillosvergabe zwingt und die Auftraggeber nicht die nötige Flexibilität bietet, bedarfsgerecht zu reagieren, geben keine Antwort. Nur durch eine Vielzahl an kleinen, mittleren und großen Aufträgen werden alle Unternehmen der Bauwirtschaft für diese Mammutaufgabe aktiviert. Es kommt jetzt darauf an, dass alle Möglichkeiten von Vergabe und Vertragsmodellen genutzt werden, um auf unterschiedliche Projektarten, Komplexitäten und Risikoprofile von Bauprojekten reagieren zu können. Zudem wird gerade durch die Vielfalt an unterschiedlichen Vergaben die gesamte Leistungsfähigkeit der Bauwirtschaft aktiviert.“
Ein besonderes Augenmerk legt Müller auf die Planungszeiten, insbesondere beim Ersatzneubau von Brücken. Diese müssten auf maximal ein Jahr verkürzt werden – durch straffere Verfahren, kürzere Fristen und den Verzicht auf unnötige Planungsschritte. Dass solche Beschleunigungen möglich seien, habe das Beispiel des Bundeswehr-Beschleunigungsgesetzes bereits gezeigt.
Rüstungsinvestitionen erfordern strategische Beschaffungsstrukturen
Während dieses Gesetz als Vorbild für Infrastrukturprojekte dient, rücken im militärischen Bereich andere Herausforderungen in den Vordergrund. Denn mit den geplanten Investitionen in die Bundeswehr wächst auch der Druck, das Beschaffungswesen grundlegend neu aufzustellen. Prof. Dr. Michael Eßig von der Universität der Bundeswehr in München sieht zusätzlichen Investitionsmittel zwar als wichtigen Schritt – macht jedoch auch deutlich, dass es nun Zeit für tiefergehende Reformen im Beschaffungswesen ist. Öffentliche Beschaffung werde vielerorts noch immer als rein administrativer Akt verstanden, kritisiert Eßig. Dabei sei sie mit mehr als einem Drittel der Staatsausgaben einer der zentralen Hebel staatlicher Leistungsfähigkeit. Notwendig sei ein strategisches Verständnis von Beschaffung – mit frühzeitiger Markterkundung, besserer personeller Ausstattung und der Entwicklung differenzierter Beschaffungsstrategien.
„Beschaffung wird immer wieder als Verwaltungsakt verstanden, als reine Abwicklung von Vergaben. Mit den massiv steigenden Investitionsmitteln muss also das lange beschworene Verständnis einer strategischen Beschaffung tatsächlich in der Praxis Einzug halten. Dazu gehören ganz viele Elemente – neben einer sachlich wie personell adäquaten Ausstattung sind dies die frühzeitige Einbindung in den Beschaffungsprozess, das grundlegende Prozessverständnis, welches weitaus „mehr“ als Vergabe umfasst und bereits beim Bedarfsmanagement beginnt, die massiv steigende Bedeutung der Markterkundung, die Definition adäquater Rollenkonzepte wie bspw. die der/des strategischen Einkäufers/strategische Einkäuferin, die Definition und Umsetzung adäquater Beschaffungsstrategien.“
Eßig betont, dass es dazu auch differenzierte Beschaffungsstrategien brauche, die sowohl klassische Rüstungsgüter als auch innovative Lösungen berücksichtigen – je nach Marktlage, Produktart und Bedarfsträger. Strategische Beschaffung bedeute, ein Beschaffungsportfolio zu entwickeln, das sich an konkreten Bedarfen orientiert, ein tiefes Verständnis von Lieferanten und Märkten voraussetzt und den Wettbewerb nicht nur rechtlich absichert, sondern aktiv gestaltet.
BUND sieht erheblichen Mehrbedarf bei Klima- und Naturschutzinvestitionen
Prioritäten setzen für mehr Geschwindigkeit in den Vergabeverfahren
Mit dem Sondervermögen verbinden sich große Erwartungen – nicht nur in Bezug auf die Höhe der Mittel, sondern vor allem auf deren schnelle und wirksame Umsetzung. Marco Junk, Geschäftsführer des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW), kritisiert in diesem Zusammenhang die politische Forderung nach mehr Effizienz als verkürzt und wenig differenziert. Die öffentliche Beschaffung arbeite bereits seit Langem zielgerichtet – die eigentlichen Verzögerungen seien politisch mitverursacht.
„Aus der Politik ist nun vielfach zu hören, die bereitgestellten Mittel müssten „zielgerichtet und effizient“ eingesetzt werden – als wäre das bislang nicht ohnehin der Anspruch gewesen. Diese Aussage wird den vielen qualifizierten und engagierten Beschafferinnen und Beschaffern in Deutschland nicht gerecht. Denn es war in erster Linie die Politik selbst, die das Vergaberecht in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl politischer Zielsetzungen jenseits der eigentlichen Bedarfserfüllung überfrachtet hat – mit dem Ergebnis, dass Verfahren nicht etwa schlanker oder schneller, sondern komplexer und langwieriger wurden. Wenn jetzt Geschwindigkeit gefordert ist, braucht es die Bereitschaft, einige dieser sicher gut gemeinten, aber sekundären Zielvorgaben zumindest vorübergehend zurückzustellen – ganz im Sinne von: erst die Pflicht, dann die Kür.“
Für den Bereich der Bundeswehr spricht sich Junk dafür aus, künftig stärker auf europäische Standards statt auf aufwendige Sonderlösungen – sogenannte „Goldrandlösungen“ – zu setzen. Diese seien nicht nur teurer und in der Planung deutlich zeitaufwändiger, sondern aufgrund ihrer individuellen Ausgestaltung auch anfälliger für Fehler. Eine konsequente Standardisierung könne hier wesentlich zur Beschleunigung und Effizienzsteigerung in der Beschaffung beitragen.











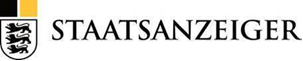
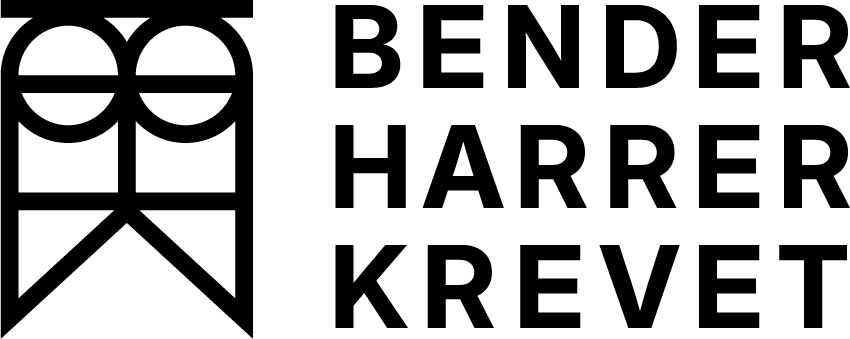
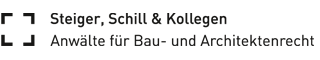
Schreibe einen Kommentar