 Die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde soll ausgeschlossen werden, wenn der Antragsteller in erster Instanz unterliegt. So sieht es der Referentenentwurf des Vergabebeschleunigungsgesetzes vor. Damit wäre gerichtlicher Primärrechtsschutz faktisch nicht mehr zu erreichen. Das wirft nicht nur europa- wie verfassungsrechtliche Bedenken auf, die die Gesetzesbegründung nicht auszuräumen vermag. Vor allem ist es ein Rückschritt in längst überwundene vergaberechtliche Denkmuster – ein Rollback in die Neunziger.
Die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerde soll ausgeschlossen werden, wenn der Antragsteller in erster Instanz unterliegt. So sieht es der Referentenentwurf des Vergabebeschleunigungsgesetzes vor. Damit wäre gerichtlicher Primärrechtsschutz faktisch nicht mehr zu erreichen. Das wirft nicht nur europa- wie verfassungsrechtliche Bedenken auf, die die Gesetzesbegründung nicht auszuräumen vermag. Vor allem ist es ein Rückschritt in längst überwundene vergaberechtliche Denkmuster – ein Rollback in die Neunziger.
1. Der Referentenentwurf: Ausschluss der aufschiebenden Wirkung
Nicht alles, was in Koalitionsverträgen steht, findet den Weg ins Gesetzblatt. Doch der vom BMWE vorgelegte Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge“ macht Ernst mit der in der Koalitionsvereinbarung angedeuteten Abschaffung des gerichtlichen Primärrechtsschutzes im Vergaberecht. § 173 Abs. 1 und 2 GWB soll künftig durch folgende Vorschrift ersetzt werden (Art. 1 Nr. 34 des Gesetzentwurfs):
„Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, hat die sofortige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer.“
Ist der Antragsteller unterlegen, entfällt das Zuschlagsverbot künftig unmittelbar mit der Entscheidung der Vergabekammer, nicht erst nach Ablauf der Beschwerdefrist. Denn es wird ein neuer § 169 Abs. 1 Satz 2 GWB eingefügt. Das Zuschlagsverbot wirkt nur fort, wenn die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des Zuschlags abgelehnt hat. Der unterlegene Antragsteller wird künftig keine sofortige Beschwerde mehr einlegen. Das Recht auf gerichtliche Überprüfung wird zur Makulatur, nachdem der Zuschlag erteilt wurde. Denn Antragsteller im Nachprüfungsverfahren streben nicht nach der Bestätigung ihres Rechtsstandpunktes (durch eine „Feststellungsentscheidung“), sie wollen den Auftrag.
2. Europa- und verfassungsrechtlich fragwürdige Begründung
Die Entwurfsbegründung hält diesen faktischen Ausschluss des gerichtlichen Primärrechtsschutzes für zulässig. Das Europarecht verlange nur eine gerichtliche Instanz, so der EuGH in der Sache CROSS (Urt. v. 18.01.2024, Rs. C-303/22).
Ein Blick in Art. 2 Abs. 9 der Rl. 2007/66/EU ist hilfreich:
„Eine Nachprüfungsstelle, die kein Gericht ist, muss ihre Entscheidung stets schriftlich begründen. Ferner ist in diesem Falle sicherzustellen, dass eine behauptete rechtswidrige Maßnahme der Nachprüfungsstelle oder ein behaupteter Verstoß bei der Ausübung der ihr übertragenen Befugnisse zum Gegenstand einer Klage oder einer Nachprüfung bei einer anderen von dem öffentlichen Auftraggeber und der Nachprüfungsstelle unabhängigen Stelle, die ein Gericht im Sinne des Artikels 234 des Vertrags ist, gemacht werden können.“
Die Richtlinie geht also davon aus, dass „Nachprüfungsstellen“ eingerichtet werden. Deren Entscheidungen müssen gerichtlich überprüfbar sein, wenn sie selbst keine Gerichte sind. Nun meint der Entwurf, die Vergabekammern seien ja Gerichte im Sinne der Rechtsmittelrichtlinie, da der EuGH die Vorlageberechtigung der Vergabekammer nach Art. 267 AEUV (früher: Art. 234 EGV) bekanntlich bejaht habe. Art. 2 Abs. 9 der Rechtsmittelrichtlinie 2007/66/EU verlange zwar die Überprüfung durch ein Gericht, jedoch nur die Überprüfung durch ein Gericht im Sinne des Art. 267 AEUV. Gericht in diesem Sinne sei die Vergabekammer, einer Überprüfung durch ein (weiteres) Gericht bedürfe es nicht. Aber die Vergabekammer ist nun einmal nach deutschem Recht eine „Nachprüfungsstelle, die kein Gericht ist“. Dass die Rechtsmittelrichtlinie die Entscheidungen solcher nichtgerichtlicher Instanzen überprüfungsfrei stellen will, kann aus der Entscheidung über die Vorlageberechtigung der Vergabekammern wohl kaum geschlossen werden.
Verfassungsrechtlich soll aber alles in Ordnung sein, denn Art. 19 Abs. 4 GG finde keine Anwendung. Das habe das Bundesverfassungsgericht bestätigt, da der Staat als Nachfrager nicht hoheitlich handele. Das Bundesverfassungsgericht habe im Beschluss vom 13.06.2006 (1 BvR 1160/03) entschieden, es obliege der zulässigen Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers, im Hinblick auf Vergabeentscheidungen das Interesse des Auftraggebers und des erfolgreichen Bieters an einer zügigen, wirtschaftlichen Abwicklung des öffentlichen Auftrags dem Interesse des Beschwerdeführers an Primärrechtsschutz vorzuziehen und diesen auf Sekundärrechtsschutz zu beschränken. Diese zum Unterschwellenrecht ergangene Entscheidung sei auf den Anwendungsbereich des Vierten Teils des GWB übertragbar.
Die in Bezug genommene Entscheidung des BVerfG gibt diese Schlussfolgerungen freilich nicht her, im Gegenteil. In dem Verfahren ging es um die Frage, ob aufgrund des Gleichheitssatzes der Unterschwellenrechtsschutz ebenso effizient ausgestaltet sein muss wie das Rechtsschutzsystem des GWB. Das hat das BVerfG verneint. Daraus den Umkehrschluss zu ziehen, der europarechtlich determinierte Oberschwellenrechtsschutz dürfe ebenso ineffizient sein wie der unterhalb der Schwelle, ist nicht nur methodisch unkorrekt. Aus den Entscheidungsgründen des BVerfG folgt anderes. Das BVerfG betonte die Unterschiede zwischen dem europarechtlich determinierten Vergaberecht des GWB, das der Durchsetzung subjektiver Rechte dient, gegenüber dem Unterschwellenbereich, wo „das Vergaberecht Teil des öffentlichen Haushaltsrechts und insofern Innenrecht der Verwaltung“ bleibe (juris, Rn. 15). Daher dürfe der Gesetzgeber beide Sphären unterschiedlich behandeln. Dass der Rechtsschutz oberhalb der Schwelle effizienter sein muss als unterhalb, legt die Entscheidung des BVerG näher als die Entwurfsbegründung wahrhaben will.
3. Rollback in die Neunziger
Ein Blick zurück: Noch bis in die zweite Hälfte der neunziger Jahre hatte sich der deutsche Gesetzgeber dagegen gesträubt, den Bietern Ansprüche in Gestalt subjektiver Rechte zuzuerkennen, das Vergaberecht sollte Teil des Haushaltsrechts bleiben. Zur Umsetzung der Rechtsmittelrichtlinie hatte man seinerzeit die „haushaltsrechtliche Lösung“ ersonnen, die in Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) die Überprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge (nur) durch sog. Vergabeprüfstellen und Vergabeüberwachungsausschüsse vorsah, aber gerichtlichen Rechtsschutz ausschloss. Man musste aber – nicht zuletzt aufgrund eines Vertragsverletzungsverfahrens – einsehen, dass die Vergaberichtlinien (auch) der Durchsetzung fairer Marktzutrittschancen der Unternehmen dienen und mithin subjektive Rechte begründen. Daher wurde das Vergaberechtsänderungsgesetz beschlossen, das zum 1.1.1999 den Anspruch der Unternehmen auf die Einhaltung der Vorschriften über das Vergabeverfahren begründete (heute: § 97 Abs. 6 GWB) und das Nachprüfungsverfahren mit dem bis heute geltenden Instanzenzug Vergabekammer – OLG einführte. Es lohnt ein Blick in die Darstellung der Zielsetzung des Vergaberechtsänderungsgesetzes in der Gesetzesbegründung vom 03.12.1997 (BT-Drs. 13/9340):
„Das Gesetz dient der vollständigen Umsetzung der EG-Richtlinien im Bereich des öffentlichen Auftragswesens. Im Einklang mit dem europäischen Recht sollen die Bieter einen Anspruch darauf haben, daß die ihren Schutz bezweckenden Vergabevorschriften von den Vergabestellen eingehalten werden. Dies zieht im Hinblick auf Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes notwendigerweise einen gerichtlichen Rechtsschutz nach sich.“ (Hervorhebung nicht im Orig.).
Die Anwendbarkeit der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG stand für den Gesetzgeber seinerzeit außer Frage. Der Staat beschafft zwar mit Mitteln des Zivilrechts, ist aber kein Nachfrager wie jeder andere. Schließlich gibt es aus guten Gründen ein Sonderbeschaffungsrecht, das eben nur für den öffentlichen Auftraggeber gilt.
Auch damals schon sahen interessierte Kreise das öffentliche Auftragswesen des Abendlandes dem Untergang geweiht. Flächendeckende Rechtsmittel würden zu einem totalen Auftragsattentismus führen. So weit ist es bekanntlich nicht gekommen. Stattdessen hat sich das Vergaberecht nicht zuletzt durch die Spruchpraxis der Oberlandesgerichte und des BGH zu einem „erwachsenen“, dogmatisch durchdeklinierten Rechtsgebiet entwickelt. Dass Bieter das Recht haben, rechtswidrige Entscheidungen einem Gericht zur Überprüfung zu stellen, ist die Konsequenz der durch die Umsetzung der EU-Richtlinie gebotenen „kopernikanischen Wende“ des deutschen Vergaberechts: Vom bloßen Verwaltungsbinnenrecht zum Instrument der Durchsetzung des fairen und transparenten Wettbewerbs, im Interesse der Wettbewerber.
Der faktische Ausschluss der gerichtlichen Überprüfbarkeit durch den vor der Vergabekammer unterlegenen Bieter ist nicht nur ein „Rollback“ in die neunziger Jahre. Die Einheitlichkeit und die Fortentwicklung der vergaberechtlichen Rechtsprechung ist gefährdet, wenn die Oberlandesgerichte keine Gelegenheit mehr haben, Entscheidungen der Vergabekammern zu korrigieren. Die Spruchpraxis in den Ländern mag sich in Bereichen, in denen gegen die Antragsteller entschieden wird, unterschiedlich entwickeln. Gibt es faktisch keine Beschwerdemöglichkeit mehr, kann ein vergaberechtlicher Flickenteppich zwischen den Bundesländern und auch innerhalb eines Bundeslandes entstehen. Gelegenheit zur Vorlage an den BGH – die nur den OLG offensteht – wird es nicht mehr häufig geben.
Der empfindliche Verlust an Rechtsschutz und auch an Rechtssicherheit wird mit einem minimalen Beschleunigungseffekt erkauft. Überzeugend hat Summa an dieser Stelle auf die im Verhältnis zur Gesamtzahl der Vergabeverfahren, aber auch im Verhältnis zur Zahl der Nachprüfungsverfahren äußerst geringen Fallzahlen in der Beschwerdeinstanz hingewiesen. Kurzum: Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde bringt nichts für die Beschleunigung.
Der Entwurf soll dem Vernehmen nach bereits am 16.07. im Bundeskabinett beraten werden. Die Verbände wurden bislang nicht angehört. Es bleibt nur der Appell: Lasst ab von diesem Unfug.
Dr. Olaf Otting
Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Otting Zinger Rechtsanwälte mit Sitz in Hanau. Als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht berät Dr. Olaf Otting öffentliche Auftraggeber, Unternehmen und Investoren in allen Fragen des öffentlichen Rechts. Er ist vor allem spezialisiert auf Vergabe-, Bau- und Immobilienrecht.











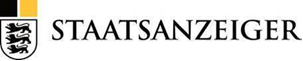
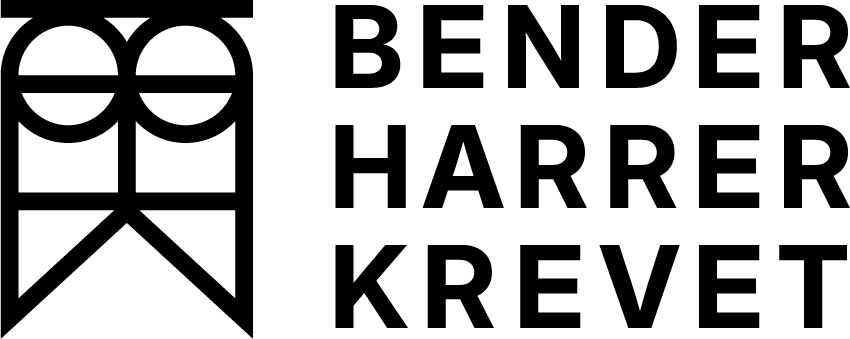
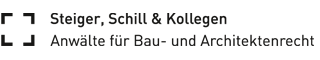
Schreibe einen Kommentar