 Die Preisaufklärung stellt Vergabestellen vor erhebliche rechtliche und praktische Herausforderungen und ist aktuell ein zentrales Thema der vergaberechtlichen Spruchpraxis. Sie berührt die Kalkulationsfreiheit der Bieter genauso wie die Frage nach deren Leistungsfähigkeit. § 60 VgV gestattet Auftraggebern, den Zuschlag auf ungewöhnlich niedrige Angebote abzulehnen. Vor Ablehnung sind sie allerdings verpflichtet, die betreffenden Angebote aufzuklären und zu überprüfen. Voraussetzungen und Rechtsfolgen dieser Prüfungspflicht sind im Detail und in der Praxis noch nicht abschließend geklärt: Wann ist eine Preisaufklärung konkret erforderlich? Wie sollte sie durchgeführt werden? Wann darf sich der Auftraggeber mit Erklärungen des Bieters zufriedengeben? Und in welchem Umfang können Aufklärung und Ergebnis durch die Nachprüfungsinstanzen überprüft werden?
Die Preisaufklärung stellt Vergabestellen vor erhebliche rechtliche und praktische Herausforderungen und ist aktuell ein zentrales Thema der vergaberechtlichen Spruchpraxis. Sie berührt die Kalkulationsfreiheit der Bieter genauso wie die Frage nach deren Leistungsfähigkeit. § 60 VgV gestattet Auftraggebern, den Zuschlag auf ungewöhnlich niedrige Angebote abzulehnen. Vor Ablehnung sind sie allerdings verpflichtet, die betreffenden Angebote aufzuklären und zu überprüfen. Voraussetzungen und Rechtsfolgen dieser Prüfungspflicht sind im Detail und in der Praxis noch nicht abschließend geklärt: Wann ist eine Preisaufklärung konkret erforderlich? Wie sollte sie durchgeführt werden? Wann darf sich der Auftraggeber mit Erklärungen des Bieters zufriedengeben? Und in welchem Umfang können Aufklärung und Ergebnis durch die Nachprüfungsinstanzen überprüft werden?
Die hiermit im Zusammenhang stehenden Sachverhalte sind regelmäßige Begleiter im Vergabealltag und eine häufige Streitquelle. Nachfolgend sollen deshalb Voraussetzungen, Durchführung und Nachprüfung der Preisaufklärung nach § 60 VgV dargestellt und systematisiert werden.
I. Einführung
Haushalterisches Interesse öffentlicher Auftraggeber ist eine möglichst wirtschaftliche Beschaffung. Preis und Leistung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Je günstiger die Angebote, desto weniger Ausgaben haben öffentliche Auftraggeber. Zum anderen soll der Bieter und spätere Auftragnehmer aber auch Gewähr dafür bieten, den Auftrag zu den angebotenen Konditionen und in der geforderten Qualität tatsächlich zu erfüllen.
Die Pflicht, ungewöhnlich niedrige Angebote nach § 60 VgV nicht zu bezuschlagen, beruht auf den Risiken ungewöhnlich niedriger Angebote für die Vertragsdurchführung. Angebote, die nur sehr knapp oder nicht auskömmlich kalkuliert sind, können zu Qualitätsmängeln, Nachtragsforderungen oder sogar zum Scheitern der Leistung führen. Um solche Risiken zu minimieren, müssen öffentliche Auftraggeber besonders günstige Angebote kritisch hinterfragen. Dieses Interesse an letztlich fairem Wettbewerb haben nicht nur Auftraggeber sondern auch die Mitbewerber im jeweiligen Vergabeverfahren.
Die Aufklärung steht dabei im Spannungsfeld zwischen Kalkulationsfreiheit der Bieter einerseits und dem Wettbewerbsprinzip des Vergaberechts andererseits. Grundsätzlich soll das Vergabeverfahren dazu dienen, wirtschaftliche Angebote zu identifizieren und sicherzustellen, dass öffentliche Auftraggeber nicht unnötig hohe Preise zahlen. Ein allzu striktes Vorgehen gegen günstige Angebote kann allerdings auch die Kalkulationsfreiheit der Bieter und damit auch den Wettbewerb einschränken und dazu führen, innovative oder besonders effiziente Anbieter zu benachteiligen.
Die Abgrenzung zwischen einem legitimen, wirtschaftlich kalkulierten Angebot und einem knapp oder nicht auskömmlichen, risikobehafteten Angebot ist daher eine zentrale Herausforderung in der Vergabepraxis. In der Spruchpraxis der Nachprüfungsinstanzen haben sich hierzu Eckpunkte herausgebildet, wann eine Preisaufklärung erforderlich ist, in welchem Umfang sie durchzuführen und ab wann ein Ausschluss gerechtfertigt ist. Die Rechtsentwicklung ist hierzu aber noch nicht abgeschlossen.
II. Das Verfahren
Erscheinen die Preise oder Kosten eines Angebots im Verhältnis zur geforderten Leistung ungewöhnlich niedrig, ist der öffentliche Auftraggeber verpflichtet, das Angebot zu überprüfen und Aufklärung zu verlangen, § 60 Abs. 1 VgV.
Dieses sogenannte Zwischenverfahren dient der Aufklärung und Bewertung der Angemessenheit des Angebots. Nach der Begründung des Verordnungsgebers trägt diese Vorschrift dem Anspruch des betroffenen Bieters auf rechtliches Gehör Rechnung[i].
Andererseits ist das Preisaufklärungsverfahren kein Selbstzweck. Die Vergabestelle kann in Ausnahmefällen von einer Aufklärung absehen, wenn bereits aufgrund anderer belastbarer Erkenntnisse ersichtlich ist, dass das Angebot des Bieters nicht ungewöhnlich niedrig ist. Solche Erkenntnisse können sich etwa aus Marktpreisanalysen, Erfahrungswerten aus vergleichbaren Ausschreibungen oder der Auftragswertschätzung des Auftraggebers ableiten. Allerdings birgt dieses Vorgehen erhebliche Risiken, da das Gesetz ausdrücklich eine Aufklärung „beim Bieter“ fordert[ii].
1. Aufgreifschwelle
Die Einleitung des Zwischenverfahrens setzt voraus, dass der Angebotspreis oder die angebotenen Kosten ungewöhnlich niedrig erscheinen. Nach obergerichtlicher Rechtsprechung ist dies der Fall, wenn ein „offenbares Missverhältnis zur Leistung“ besteht.
In der Praxis hat sich zur Identifizierung ungewöhnlich niedriger Preise ein Vergleich mit den übrigen Angeboten als gängige Methode etabliert. Der Preisvergleich und die daraus abgeleitete sogenannte „Aufgreifschwelle“ kann zwar ein hilfreicher Indikator sein, darf jedoch nicht dazu führen, dass öffentliche Auftraggeber ihre Entscheidung über das „ob“ einer Preisaufklärung ausschließlich auf den Preisabstand stützen.
Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Veridos-Entscheidung[iii], klargestellt, dass die Bewertung, ob ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, stets im Verhältnis zur ausgeschriebenen Leistung erfolgen muss. Im Rahmen dieser Prüfung kann und sollte der öffentliche Auftraggeber daher alle relevanten Aspekte berücksichtigen, die im Hinblick auf die konkret geforderte Leistung von Bedeutung sind, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. So sehr der Vergleich mit konkurrierenden Angeboten in den meisten Fällen zur Feststellung eines ungewöhnlich niedrigen Preises dienlich sein mag, darf er keinesfalls das alleinige Kriterium für die Bewertung darstellen.
a. Absolute Aufgreifschwelle
Ein Angebotspreis gilt als ungewöhnlich niedrig, wenn er erheblich von den Vergleichswerten abweicht. Nach herrschender Meinung besteht eine Prüfpflicht des Auftraggebers dann, wenn der Preisabstand zum nächsthöheren Angebot mindestens 20 % der Gesamtauftragssumme beträgt. Dabei wird das nächsthöhere Angebot als 100 % gewertet[iv].
Mit anderen Worten: bei Überschreiten dieses Preisabstandes muss der Auftraggeber aufklären.
b. Relative Aufgreifschwelle
In der Literatur wird vertreten, unterhalb eines Preisabstands von 20 % liege eine sog. relative Aufgreifschwelle. Bei Abweichungen zwischen 10 und 20 % sei der öffentliche Auftraggeber berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine Preisaufklärung durchzuführen – insbesondere dann, wenn Auffälligkeiten im Angebot vorliegen. In diesem Bereich wird dem Auftraggeber regelmäßig ein Entscheidungsspielraum zuerkannt[v].
Diese relative Aufgreifschwelle ist bislang nicht ausdrücklich in der Rechtsprechung anerkannt. Insbesondere haben sowohl das Oberlandesgericht Düsseldorf als auch der Bundesgerichtshof in ihrer bisherigen Entscheidungspraxis offengelassen, unter welchen Voraussetzungen bei einem Preisabstand von weniger als 20 % eine Preisprüfung erforderlich ist[vi].
In einigen Ländern existieren insoweit landesrechtliche Vorgaben, die zu einer Preisaufklärung ab 10 % Preisabstand verpflichten[vii]. Diese Vorgaben dürften auch für Vergaben nach dem GWB in jenen Ländern gelten.
Das OLG Frankfurt[viii] hat ferner in einem Fall mit einem Preisabstand von 16 % ausdrücklich das Recht des Auftraggebers zur Aufklärung bejaht. Dabei wurde betont, dass der Vergleich nicht allein auf das Angebot des zweitplatzierten Bieters zu stützen sei. Vielmehr sei stets eine umfassende Würdigung der Umstände des konkreten Einzelfalls erforderlich. Unterhalb der Preisdifferenz von 20 % besteht daher ein Ermessen oder Beurteilungsspielraum der Auftraggeber hinsichtlich der Einleitung einer Preisaufklärung[ix].
In der Rechtsprechung fehlen bislang jedoch belastbare, konkrete Kriterien, die Auftraggebern als Anhaltspunkte dienen könnten, wann eine Preisaufklärung innerhalb dieser Bandbreite geboten ist. Eine normative Leitlinie oder dogmatisch gefestigte Schwelle existiert nicht. Die Entscheidung bleibt daher regelmäßig eine Einzelfallbeurteilung.
Das entspricht auch der Veridos-Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2023. Hier hat er ausdrücklich hervorgehoben, dass die Beurteilung, ob ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, stets im Verhältnis zur ausgeschriebenen Leistung zu erfolgen hat. Dies spricht gegen pauschale Schwellenwerte und für eine inhaltliche Prüfung des konkreten Angebots im Kontext der geforderten Leistung.
Deshalb können auch bei einem Preisabstand von unter 20 % im Einzelfall Preisprüfungen geboten sein. In der Praxis zeigen sich zahlreiche Fallkonstellationen, in denen auch unterhalb der 20 %-Marke eine vertiefte Prüfung angezeigt oder erforderlich sein kann:
- Niedriges allgemeines Preisniveau: Ist das Wettbewerbsumfeld insgesamt durch sehr niedrige Preise geprägt, kann bereits eine geringe Abweichung – etwa von 5-10 % – auf eine nicht mehr auskömmliche Kalkulation hinweisen.
- Hoher Auftragswert: Bei großvolumigen Vorhaben (z. im Infrastruktur- oder Hochbau) bewirken selbst Preisunterschiede von 5–10 % erhebliche absolute Beträge, die wirtschaftlich ins Gewicht fallen.
- Auffällige Einzelpositionen: Weicht ein Angebot in einzelnen Positionen stark vom Marktniveau oder von Vergleichsangeboten ab, kann dies auf Kalkulationsfehler, strategische Preisbildung (z. Mischkalkulation) oder unklare Leistungsbeschreibungen hinweisen.
- Knapp kalkulierte Lohnanteile: Gerade bei personalintensiven Leistungen (z. Gebäudereinigung, Pflege, Sicherheitsdienste) können auffällig niedrige Personalkosten Hinweise auf eine unzulässige Unterkalkulation oder auf Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorgaben liefern.
- Technisch oder wirtschaftlich riskante Leistungsteile: Wird bei technisch komplexen oder wirtschaftlich risikobehafteten Teilleistungen besonders günstig kalkuliert, kann dies auf eine unzureichende Risikoabschätzung oder eine unrealistische Projektbewertung hindeuten.
- Marktferne oder unplausible Kalkulation: Weichen Preisansätze deutlich von marktüblichen Einkaufspreisen, branchenüblichen Stundensätzen oder Erfahrungswerten ab, kann dies ein weiteres Indiz für ein ungewöhnlich niedriges Angebot darstellen.
- Auffällige Quersubventionierung: Wenn einzelne Positionen überteuert, andere aber extrem günstig angeboten werden, kann dies strategischen Charakter haben und sollte auf Vorliegen einer Mischkalkulation und wirtschaftliche Schlüssigkeit geprüft werden.
- Erfahrungen mit dem Bieter aus der Vergangenheit: Liegen dem Auftraggeber belastbare Hinweise vor, dass der Bieter in früheren Projekten auf Basis nicht tragfähiger Kalkulationen Leistungen nicht oder nur mit erheblichen Mängeln erfüllt hat, kann dies eine vertiefte Prüfung rechtfertigen
Diese Beispiele zeigen, dass eine rein schematische Anwendung von Schwellenwerten den komplexen wirtschaftlichen und vergaberechtlichen Realitäten nicht gerecht wird. Vielmehr bedarf es einer differenzierten Betrachtung, die sowohl die wirtschaftliche Tragfähigkeit als auch die technische Realisierbarkeit der Angebote einbezieht.
Die pauschale Orientierung an der starren Aufgreifschwelle mag insoweit zwar praktikabel sein. Deren unreflektierte Anwendung birgt aber auch erhebliche Risiken: Unwirtschaftliche Angebote könnten unentdeckt bleiben oder – umgekehrt – wirtschaftlich sinnvolle Angebote unnötig ausgeschlossen werden. Um Fehlentscheidungen vorzubeugen, sollten öffentliche Auftraggeber bei Auffälligkeiten im Angebot ihre Entscheidung zur (Nicht-)Aufklärung deshalb nachvollziehbar dokumentieren und dabei sowohl rechtliche Anforderungen als auch sachliche Erwägungen sorgfältig abwägen.
2. Aufklärungsumfang, § 60 Abs. 2 VgV
Erscheint der Angebotspreis ungewöhnlich niedrig, ist der Auftraggeber nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, eine Preisaufklärung durchzuführen. Ein Ermessensspielraum besteht hierbei nicht – die Aufklärung muss zwingend erfolgen, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind[x].
Dem betroffenen Bieter ist die Gelegenheit zu geben, seinen Preis zu erklären und die Risiken des ungewöhnlich niedrigen Preises zu entkräften. Er kann / muss dabei je nach Fallgestaltung auch Gründe darlegen, warum sein Angebot gemäß auskömmlich kalkuliert ist, vgl. § 60 Abs. 3 Satz 1 VgV.
Die Aufforderung zur Aufklärung erfolgt in Textform gemäß § 126 BGB. Dabei muss für den Bieter klar erkennbar sein, dass der Auftraggeber formell in das Preisaufklärungsverfahren nach § 60 Abs. 2 VgV eingetreten ist. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Bieter durch gezielte, positions- oder titelbezogene Anfragen eine konkrete Möglichkeit zur Aufklärung zu geben. Der Bieter soll nachvollziehbar darlegen können, dass und wie er die Leistung auftragsgerecht und gesetzeskonform erbringen kann.
Pauschale Aufforderungen, die gesamte Kalkulation offenzulegen, genügen den Anforderungen an eine sachgerechte Preisaufklärung nicht. Ohne gezielte Nachfragen kann der Bieter, der sein Angebot im Rahmen der ihm zustehenden Kalkulationsfreiheit erstellt hat, nicht erkennen, auf welche Positionen oder Titel sich die Zweifel des Auftraggebers beziehen[xi]. Der Auftraggeber muss mithin seine Bedenken gegen den angebotenen Preis idealerweise an konkreten Positionen des Angebots deutlich machen.
In der Praxis häufig geforderte oder abgegebene Eigenerklärungen, in denen der Bieter allgemein versichert, sein Angebot sei auskömmlich kalkuliert, sind daher wirkungslos. Erst recht reicht es nicht aus, den Bieter lediglich in einem Gespräch auf mögliche Zweifel an der Angemessenheit seiner Preise hinzuweisen. Ein solcher Verfahrensfehler kann jedoch im Nachprüfungsverfahren durch eine nachträgliche Anhörung geheilt werden – ebenso wie eine vollständig unterbliebene Preisaufklärung[xii].
3. Die Mitwirkungsobliegenheit des Bieters
Nach einer ordnungsgemäßen Aufforderung trifft den Bieter eine Mitwirkungsobliegenheit. Er hat nun die Gelegenheit, die „Seriosität“ seines Angebots zu belegen. In diesem Zusammenhang liegt die Darlegungs- und Beweislast bei dem Bieter[xiii]. Dies ist auch sachgerecht, da ausschließlich der Bieter selbst über seine innerbetrieblichen und geschäftlichen Verhältnisse Auskunft geben kann, während der Auftraggeber keine Kenntnis von den internen Betriebsstrukturen des Bieters hat[xiv].
Die Erklärungen des Bieters müssen in sich schlüssig, nachvollziehbar und anhand geeigneter Belege objektiv überprüfbar sein. Geeignet sind zum Beispiel Eigenerklärungen des Bieters sowie relevante Unterlagen. Auch Testate, wie etwa ein Wirtschaftsprüfertestat, können als Nachweis dienen. Formelhafte, inhaltsleere oder abstrakte Erklärungen ohne Bezug zu den einzelnen Angebotspositionen, wie etwa allgemeine Hinweise auf innerbetriebliche Strukturen oder wirtschaftliche Parameter, reichen nicht aus, um die Seriosität des Angebots nachzuweisen.
Verweigert der Bieter eine Aufklärung, hält er von der Vergabestelle gesetzte zumutbare Fristen zur Beantwortung nicht ein oder gibt er lediglich formelhafte, inhaltsleere Erklärungen ab, muss die Vergabestelle dies im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung gemäß § 60 Abs. 3 Satz 1 VgV bei der Frage des Ausschlusses des Angebots berücksichtigen[xv].
Ein Hinweis auf Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ist keine zulässige Begründung für die Verweigerung der Aufklärung, da nach § 5 VgV das Gebot der Vertraulichkeit im Verhältnis zwischen Auftraggeber und Bieter gilt.
4. Der Prüfungsmaßstab
Gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 VgV ist der öffentliche Auftraggeber unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 verpflichtet, die Zusammensetzung des Angebots zu prüfen und die übermittelten Unterlagen zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass der Auftraggeber nach Vorlage der Unterlagen die Preisermittlung des Bieters konkret und eingehend überprüfen muss[xvi].
Ziel dieser Prüfung ist es, eine fundierte Grundlage für die Entscheidung nach § 60 Abs. 3 VgV zu schaffen. Diese Entscheidung basiert auf einer gesicherten Erkenntnis, ob das Angebot des Bieters voraussichtlich den Anforderungen an die Auftragsausführung gerecht wird[xvii].
Angesichts des Interesses nicht nur des öffentlichen Auftraggebers, sondern auch der Allgemeinheit an einer zügigen Umsetzung von Beschaffungsvorgängen sowie einem schnellen Abschluss von Vergabeverfahren und der begrenzten Ressourcen des Auftraggebers, sind der Überprüfungspflicht jedoch durch den Grundsatz der Zumutbarkeit Grenzen gesetzt. Die Prüfung der Unterlagen kann und muss daher nur in einem zumutbaren Rahmen erfolgen[xviii].
Für die Entscheidung des Auftraggebers reicht die fundierte Prognose darüber aus, ob der Bieter den ausgeschriebenen Auftrag voraussichtlich mangelfrei ausführen kann. Dabei muss der Auftraggeber Art und Umfang der im konkreten Fall drohenden Gefahren für eine wettbewerbskonforme Auftragserfüllung bewerten[xix].
Die Regelungen über den möglichen Ausschluss von ungewöhnlich niedrigen Angeboten basieren auf der Erfahrung, dass Preise unter einem bestimmten Niveau nicht mehr vorteilhaft, sondern riskant sein können. Niedrige Preise bergen ein erhöhtes Risiko von Leistungsstörungen und möglichen Ausfällen von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen. In diesem Fall wird das Angebot für die Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung wirtschaftlich untragbar[xx].
Dies betrifft nicht nur die Möglichkeit, dass der Auftragnehmer aufgrund der zu niedrigen Vergütung in finanzielle Schwierigkeiten gerät und den Auftrag nicht vollständig ausführen kann. Auch die Gefahr, dass der Anbieter versucht, den Auftrag möglichst ohne großen Aufwand zu erledigen, ist gegeben – etwa indem er nach Möglichkeit Nachträge verlangt, um Kompensation zu erhalten, oder die Ressourcen seines Unternehmens auf besser bezahlte Aufträge verlagert, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Schützenswerte Interessen des Auftraggebers sind bereits durch diese Risiken gefährdet[xxi].
III. Rechtsfolge: Gebundene Entscheidung
Kann der Bieter nachvollziehbar darlegen, dass er den ausgeschriebenen Auftrag trotz seines ungewöhnlich niedrigen Angebots ordnungsgemäß durchführen wird und das Angebot auskömmlich ist, verbleibt er im Vergabeverfahren.
Sollte der Bieter jedoch seinen Preis nicht hinreichend aufklären können, „darf“ der Auftraggeber den Zuschlag auf das ungewöhnlich niedrige Angebot ablehnen.
Der BGH hat dazu bereits in seiner Entscheidung vom 31.01.2017 konkretisiert, dass es sich hierbei um ein rechtlich gebundenes Ermessen handelt. Die Verwendung des Verbs „dürfen“ in § 60 Abs. 3 Satz 1 VgV ist nicht im Sinne eines Ermessensspielraums zu verstehen. Der Auftraggeber muss den Zuschlag ablehnen, wenn Unklarheiten im Angebot bestehen, die nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden können.
Es ist dem Auftraggeber somit grundsätzlich verwehrt, den Zuschlag zu erteilen, wenn er eine Diskrepanz zwischen dem ungewöhnlich niedrigen Preis und der angebotenen Leistung festgestellt hat oder wenn trotz Aufklärung noch Restzweifel bestehen[xxii].
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Aufklärungsprozess umfassend zu dokumentieren. Aus dieser Dokumentation muss nachvollziehbar hervorgehen, wie die Prüfung der Kalkulation durchgeführt wurde und auf welchen Erwägungen die Entscheidung beruht[xxiii].
IV. Sonderfall: Unterkostenangebote
Ein Sonderfall sind sogenannte Unterkostenangebote. Bei diesen Angeboten deckt die angebotene Vergütung die Kosten der Vertragserfüllung nicht. Der Bieter kann aber gleichwohl nachvollziehbare und stichhaltige Gründe für den niedrigen Preis darlegen. Nach der Rechtsprechung des BGH ist ein solches Angebot nicht automatisch unzulässig.[xxiv] Der Zuschlag kann auch auf ein Angebot erteilt werden, das für den Bieter keinen Gewinn erwarten lässt. Voraussetzung ist aber eine tragfähige Prognose, dass der Bieter dennoch zuverlässig und vertragsgemäß leisten wird.[xxv]
Im Fall eines Unterkostenangebotes müssen Bieter also zum einen durch geeignete Unterlagen legitime Gründe für seinen niedrigen Preis plausibel darlegen – beispielsweise durch strategische Überlegungen wie die Erschließung eines neuen Markts. Gleichzeitig müssen Bieter aber auch darlegen können, wie Sie im Fall der Auftragsausführung trotz nicht gedeckter Kosten vertragsgerecht leisten werden. Entscheidend ist letztlich, ob das Angebot wettbewerbskonform ist und der Bieter trotz fehlender Auskömmlichkeit über ausreichend finanzielle, personelle und organisatorische Kapazitäten verfügt, um zuverlässig leisten zu können[xxvi].
Auftraggeber müssen hier eine im Einzelfall komplexe Ermessensentscheidung treffen. Reichen die im Rahmen der Aufklärung erlangten Informationen aus, um die Risiken des Unterkostenangebotes und Zweifel an der Leistungsfähigkeit zu beseitigen? Konkret: Besteht ein erhöhtes Risiko, dass der Bieter versucht sein könnte, sich des Auftrags möglichst kostenschonend – und damit möglicherweise nicht vertragsgemäß – zu entledigen? Besteht ein erhöhtes Risiko für Nachtragsforderungen, Reduktion der Leistungsqualität oder Umlenkung betrieblicher Ressourcen auf lukrativere Projekte? Besteht ein erhöhtes Risiko des Leistungsausfalls, insbesondere bei fehlenden finanziellen oder personellen Reserven?
Die Beantwortung dieser Fragen steht im Ermessen öffentlicher Auftraggeber und kann je nach Einzelfall den Zuschlag oder die Nichtberücksichtigung des Unterkostenangebotes rechtfertigen.
V. Doppelt-bieterschützender Charakter
Ein Bieter, dessen Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint, hat unzweifelhaft Anspruch auf eine ordnungsgemäße Preisaufklärung gemäß § 60 Abs. 1 und Abs. 2 VgV, bevor sein Angebot ausgeschlossen werden darf. § 60 Abs. 1 und Abs. 2 VgV hat aber eine doppelt bieterschützende Funktion:
Zum einen darf ein wirtschaftlich günstiger Bieter nicht ohne vorherige Anhörung ausgeschlossen werden. Zum anderen haben aber auch die Wettbewerber einen eigenen Anspruch darauf, dass die Angebote ihrer Konkurrenten nach § 60 VgV ordnungsgemäß geprüft werden, um eine wettbewerbsverzerrende Unterpreisstrategie zu verhindern.
Diese doppelte Schutzwirkung des § 60 VgV wurde lange diskutiert, ist aber mittlerweile anerkannt. Der BGH hat klargestellt, dass sich Bieter auch dann auf § 60 VgV berufen können, wenn sie geltend machen, dass ein Mitbewerberangebot unangemessen niedrig ist und die Preisprüfung unzureichend durchgeführt wurde. Dies betrifft sowohl die Aufklärungspflicht (§ 60 Abs. 1 und 2 VgV) als auch die Entscheidung über den Ausschluss eines Angebots (§ 60 Abs. 3 VgV)[xxvii].
Gerichtlich anerkannt ist, dass Wettbewerber einen Anspruch auf eine Preisprüfung haben, wenn ihr Angebot um mehr als 20 % teurer ist als das des günstigsten Bieters. Noch nicht abschließend geklärt ist hingegen, in welchem Umfang ein solcher Anspruch auch bei einem geringeren Preisabstand besteht. Viel spricht insoweit für einen Anspruch der Bieter auf beurteilungs- oder ermessensfehlerfreie Entscheidung des Auftraggebers über eine Preisprüfung.
Unabhängig vom Anspruch auf Preisaufklärung besteht für Bieter – insbesondere außerhalb der VOB/A (Submission) – ein erhebliches Informationsdefizit. Das ändert aber materiell-rechtlich nichts an den guten Gründen für den Anspruch auf Preisaufklärung ober- wie unterhalb der absoluten Aufgreifschwelle von 20 % Preisabstand.
VI. Prüfungsmaßstab Nachprüfungsinstanzen
Im Vergabeverfahren steht dem öffentlichen Auftraggeber bei der Prüfung und Bewertung ungewöhnlich niedriger Angebote ein Beurteilungs- bzw. Einschätzungsspielraum zu, die sogenannte „Einschätzungsprärogative“, s.o. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob ein Angebot im Verhältnis zur ausgeschriebenen Leistung ungewöhnlich niedrig erscheint und ob Anlass zur Aufklärung besteht. Nach durchgeführter Aufklärung erstreckt sich der Spielraum auch auf die Bewertung des Ergebnisses der Preisprüfung. Die Nachprüfungsinstanzen beschränken sich in ihrer Kontrolle darauf, ob der Auftraggeber die Grenzen seines Beurteilungsspielraums eingehalten, den Sachverhalt vollständig und zutreffend ermittelt und sachgerecht gewürdigt hat. Die Entscheidung muss sich im Ergebnis als vertretbar und nachvollziehbar darstellen[xxviii].
Die Prüfkompetenz der Nachprüfungsinstanzen ist dabei in mehreren Stufen zu differenzieren:
1. Aufgreifschwelle – Pflicht zur Aufklärung oder Entscheidungsspielraum
a. Überschreitung der Aufgreifschwelle (Preisabstand ≥ 20 %)
Wird die in der Rechtsprechung anerkannte Aufgreifschwelle von regelmäßig 20 % Preisabstand zum nächsthöheren Angebot überschritten, besteht eine rechtliche Pflicht des Auftraggebers zur Preisaufklärung. Unterbleibt diese, kann die Nachprüfungsinstanz den Auftraggeber verpflichten, eine Preisprüfung durchzuführen[xxix].
b. Preisabstand unterhalb von 20 %
Liegt der Preisabstand unterhalb von 20 %, besteht nach überwiegender Auffassung keine Pflicht zur Preisprüfung, sondern zur ermessens- oder beurteilungsfehlerfreien Entscheidung über eine Preisprüfung. Der Auftraggeber hat insoweit einen Entscheidungsspielraum, ob ihm ein Angebot ungewöhnlich niedrig erscheint und er deshalb eine Preisprüfung einleitet. Die Nachprüfungsinstanzen prüfen in diesem Fall lediglich, ob der Auftraggeber einen nachvollziehbaren, vertretbaren und nicht willkürlichen Ermittlungsansatz gewählt hat, eine Preisaufklärung einzuleiten oder hiervon abzusehen[xxx].
2. Umfang der Aufklärung – Ermessen oder volle Überprüfbarkeit?
Nach Einleitung der Preisprüfung ist der Auftraggeber verpflichtet, die Zusammensetzung des Angebots zu prüfen und die übermittelten Unterlagen zu berücksichtigen (§ 60 Abs. 2 VgV). Die konkrete Ausgestaltung und Tiefe der Aufklärung (z. B. welche Nachweise gefordert werden, ob weitere Nachfragen erforderlich sind) unterliegt wiederum der pflichtgemäßen Beurteilung des Auftraggebers. Die Nachprüfungsinstanzen kontrollieren, ob die Aufklärung sachgerecht, nachvollziehbar und nicht willkürlich erfolgte, nehmen aber keine eigene inhaltliche Bewertung der Angemessenheit der Preise vor.
Die Nachprüfungsinstanzen greifen nur ein, wenn der Auftraggeber wesentliche Umstände außer Acht lässt, die Aufklärung nicht ausreichend dokumentiert oder die Entscheidung auf einer unzureichenden Tatsachengrundlage beruht[xxxi].
3. Ergebnis der Aufklärung – Prognose- und Beurteilungsspielraum
Die abschließende Bewertung, ob das Angebot nach erfolgter Aufklärung als auskömmlich und zuverlässig anzusehen ist, ist eine Prognoseentscheidung des Auftraggebers. Hierbei steht ihm ein Beurteilungsspielraum zu, der von den Nachprüfungsinstanzen nur eingeschränkt überprüft wird. Die Kontrolle beschränkt sich darauf, ob die Entscheidung auf einer tragfähigen Tatsachengrundlage und sachgerechten Erwägungen beruht[xxxii].
VII. Fazit
Voraussetzungen und Anwendung der Vorschriften zur Preisaufklärung sind geprägt von Beurteilungs- und Ermessensspielräumen des Auftraggebers, um den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles gerecht zu werden.
Eine Pflicht zur Aufklärung besteht nach der Rechtsprechung immer bei Überschreiten der Aufgreifschwelle von 20 % Preisabstand. Diese Aufgreifschwelle ist aber nicht abschließend und Preisaufklärungen können auch bei geringeren Preisabständen geboten sein. Besonders bei großvolumigen Ausschreibungen können auch geringere Preisabstände erhebliche Risiken mit sich bringen.
Auftraggeber sollten bei Auffälligkeiten im Angebot deshalb ihre Entscheidung, von einer Preisprüfung abzusehen, genauso sorgfältig dokumentieren wie die Preisaufklärung als solche. Klärt der Auftraggeber die Preise auf, bietet das größere Gewähr für die termin- und qualitätsgerechte Auftragsausführung. Das gilt insbesondere für den Fall eines Unterkostenangebotes, das nach der Rechtsprechung nicht per se vom Verfahren ausgeschlossen werden muss.
Eine ordnungsgemäße Preisaufklärung ist mithin nicht nur zweckmäßig, um etwaige Nachprüfungsanträge abzuwehren. Sie stärkt auch die Interessen des Auftraggebers für die eigentliche Auftragsausführung.
________________________________
[i] BT-Drs. 18/7319, 197; BGH, Beschl. v. 31.1.2017 – X ZB 10/16, NZBau 2017, 230.
[ii] OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20.12.2017 – VII-Verg 8/17.
[iii] EuGH, Urt. v. 15.09.2022 -C-669/20 „Veridos“
[iv] OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.05.2020, VII-Verg 26/19, juris; VK Bund, Beschl. v. 20.01.2022 – VK 2- 135/21, BeckRS 2022, 1751; Steck in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht 5. Aufl. 2024, § 60 VgV Rn. 4.
[v] Vgl. etwa Pauka/Frischmuth, in Münchener Kommentar Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2022, VgV § 60 Rn. 6.
[vi] OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20.12.2017 – VII-Verg 8/17, VPRRS 2018, 0122;
[vii] Preisaufklärung ab 10 % immer: § 15 Abs. 2 LVG LSA, § 5 SächsVergG; Preisaufklärung bei Bauleistungen ab 10 %: § 7 NTVergG, § 6 HmbVgG.
[viii] OLG Frankfurt, Beschl. v. 28.07.2022 – 11 Verg 4/22, BeckRS 2022, 22708.
[ix] Steck, in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 5. Aufl. 2024, VgV § 60 Rn. 4b.
[x] OLG Schleswig, Beschl. v. 27.10.2022 – 54 Verg 7/22, NZBau 2023, 336; OLG Düsseldorf, Beschl. vom 02.08. 17 – Verg 17/17, ZfBR 2018, 190.
[xi] VK Bund, Beschl. v. 15.11.2021, VK 1-112/21, ZfBR 2022, 193; Lausen, in: Beck’scher Vergaberechtskommentar, Bd. 2 (Hrsg. Burgi/Dreher) 3. Aufl. 2019, § 60 VgV, Rn. 15; Steck in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht 5. Auflage 2024 § 60 VgV Rn. 7.
[xii] Steck in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht 5. Auflage 2024 § 60 VgV Rn. 7.
[xiii] OLG Düsseldorf 31. 10. 2012 – VII-Verg 17/12, NZBau 2013, 333.
[xiv] Lausen in: Beck’scher Vergaberechtskommentar, Bd. 2 (Hrsg. Burgi/Dreher) 3. Auflage 2019.
[xv] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
[xvi] VK Bund, Beschl. v. 15.11. 2021 – VK 1-112/21, ZfBR 2022, 193; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.05.2020 – Verg 26/19, BeckRS 202, 4740.
[xvii] VK Bund v. 15.11.2021 – VK 1 – 112/21, juris; VK Berlin v. 13.07.2021 – VK B 2 – 12/21, juris.
[xviii] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
[xix] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492; BayObLG, Beschl. v. 29.05.2024 – Verg 20/23 e, BeckRS 2024, 12027.
[xx] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
[xxi] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
[xxii] BayObLG, Beschl. v. 29.05.2024 – Verg 20/23 e, BeckRS 2024, 12027; BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492
[xxiii] VK Bund, Beschluss vom 06.06.2023 – VK 1-39/23.
[xxiv] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
[xxv] OLG München, Beschl. v. 21.5.2010 – Verg 2/10, BeckRS 2010, 13748.
[xxvi] OLG München 17.09.2015 – Verg 3/15, NZBau 2015, 711 (717), Rn. 203; OLG Brandenburg 22.3.2011 – Verg W 18/10).
[xxvii] BGH, Beschl. V. 31.01.2017 – X ZB 10/26, ZfBR 2017, 492.
[xxviii] VK Bund, Beschl. v. 04.04.2023 – VK 2-18/23, BeckRS 2023, 9020.
[xxix] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
[xxx] OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27.10.2021, Verg 4/21, NZBau 2022, 687.
[xxxi] VK Bund, Beschl. v. 04.04.2022, VK2-24-22, VPR 2022, 107.
[xxxii] BGH, Beschl. v. 31.01.2017, ZfBR 2017, 492.
Payam Saghafee Yazdi
Payam Saghafee Yazdi ist Rechtsanwalt bei KUNZ Rechtsanwälte, Mainz. Dort berät er die öffentliche Hand und Unternehmen mit Schwerpunkt im Öffentlichen Wirtschaftsrecht und Vergaberecht. Herr Saghafee Yazdi, tritt im Streitfall für seine Mandanten vor Nachprüfungsinstanzen, Verwaltungs- und ordentlichen Gerichten auf.


 (16 Bewertungen, durchschn.: 4,56aus 5)
(16 Bewertungen, durchschn.: 4,56aus 5)








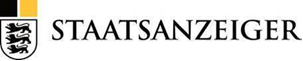
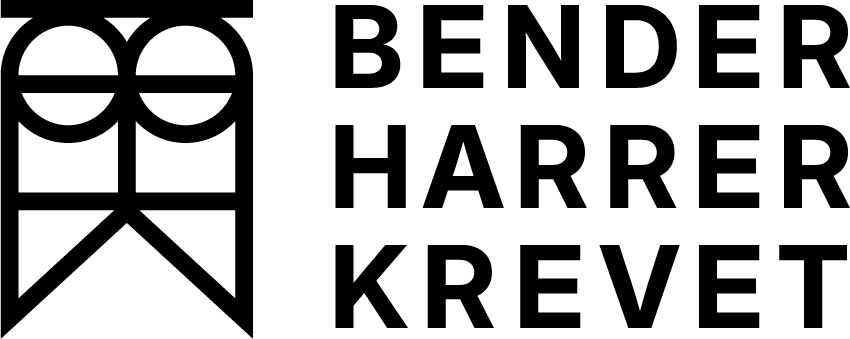
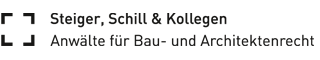
Schreibe einen Kommentar