 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – diese Binsenweisheit gilt in Vergabeverfahren nicht uneingeschränkt. Wann dürfen Auftraggeber auf Leistungsversprechen vertrauen? Wann ist hingegen eine Überprüfung geboten und wie ist eine Überprüfung durchzuführen? Diese Fragen sollen nachfolgend unter Berücksichtigung jüngerer Entscheidungen genauer beleuchtet werden. Für Bieter ist die Thematik ebenfalls relevant und hat nicht nur Auswirkungen auf Ihre Teilnahme an Vergabeverfahren, sondern darüber hinaus auf die gesamte Unternehmenspraxis.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – diese Binsenweisheit gilt in Vergabeverfahren nicht uneingeschränkt. Wann dürfen Auftraggeber auf Leistungsversprechen vertrauen? Wann ist hingegen eine Überprüfung geboten und wie ist eine Überprüfung durchzuführen? Diese Fragen sollen nachfolgend unter Berücksichtigung jüngerer Entscheidungen genauer beleuchtet werden. Für Bieter ist die Thematik ebenfalls relevant und hat nicht nur Auswirkungen auf Ihre Teilnahme an Vergabeverfahren, sondern darüber hinaus auf die gesamte Unternehmenspraxis.
Leistungsversprechen
„Leistungsversprechen“ – das bedeutet zunächst, dass die Vorgaben in den Vergabeunterlagen durch den Auftragnehmer umgesetzt werden. Ausgangspunkt ist primär die Leistungsbeschreibung bzw. das Leistungsverzeichnis. Abgesichert wird dieses Leistungsversprechen durch die Vorgabe von Eignungs- und Zuschlagskriterien durch den Auftraggeber.
Auf der Eignungsebene legt der Auftraggeber Kriterien fest und überprüft deren Erfüllung um sicherzustellen, dass die Unternehmen, die sich auf den Auftrag bewerben, die geforderten Kapazitäten zur Auftragsausführung mitbringen. Auf Zuschlagsebene sorgt der Auftraggeber dafür, dass die Leistung als solche seinen Mindestanforderungen genügt und möglichst wirtschaftlich erbracht wird.
Grundsatz: „Vertrauen“
Bei der Überprüfung, ob Bieter hinreichend leistungsfähig sind und die Leistung wie ausgeschrieben erbringen können, genießen diese grundsätzlich einen Vertrauensvorschuss. Zum Nachweis der Eignung genügt nach § 48 Abs. 2 VgV grundsätzlich die Vorlage von Eigenerklärungen. Auch im Übrigen darf der Auftraggeber im Grunde darauf vertrauen, dass der Bieter die Leistung wie im Angebot angegeben erbringen wird. Das Vertrauen in das Leistungsversprechen ist in jedem Vergabeverfahren der Grundsatz.
„Kontrolle“ nur bei konkreten Anhaltspunkten
Anlass zur weitergehenden Überprüfung des Leistungsversprechens besteht nur, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte Zweifel an der Leistungsfähigkeit bestehen. Gerade mangels einer pauschalen Überprüfungs- bzw. Aufklärungspflicht manifestieren sich solche Zweifel oft erst durch rügende Mitbewerber. Diese Rügen können den Auftraggeber im Zweifel vor einem zum Scheitern verurteilten Auftrag bewahren und sind daher nicht per se als Übel aufzufassen.
Entstehen anlässlich einer Rüge konkrete Zweifel an der Leistungsfähigkeit, hat der Auftraggeber diesen nachzugehen. Umgekehrt heißt dies jedoch auch: Eigene Ermittlungen des Auftraggebers sind erforderlich. Ein Ausschluss des vermeintlich nicht leistungsfähigen Bieters, gestützt allein auf den Vortrag des rügenden Bieters, reicht im Regelfall nicht aus.
Als Musterbeispiel, wann der Auftraggeber gehalten ist in eine Überprüfung einzusteigen, dient der folgende Fall vor dem OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.6.2024 – Verg 36/23). In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Vergabeverfahren mussten Bieter mit dem Angebot Erklärungen zur Behandlung von Verschlusssachen und Anforderungen zur Geheimschutzbetreuung abgeben. Das eingesetzte Personal musste sicherheitsüberprüft (SÜ2-VS) sein und eine Sabotageschutzprüfung absolviert haben. Der für den Zuschlag vorgesehene Bieter erklärte im Angebot und auf Nachfrage des Auftraggebers, dass er nur Personal einzusetzen beabsichtige, das die erweiterte Sicherheitsüberprüfung („SÜ2“) besitze. Ein Konkurrent rügte die Zuschlagsentscheidung und bemängelte, dass sich der für den Zuschlag vorgesehene Bieter nicht in der Geheimschutzbetreuung des BMWK (heute: „BMWE“) befinde. Die Aufnahme in die Geheimschutzbetreuung dauere 9 Monate und erst danach könne die entsprechend Ü2 VS-Schutz Überprüfung, die ebenfalls wiederum zwischen fünf und neun Monate in Anspruch nehme, beginnen. Dadurch sei es dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter nicht möglich, rechtzeitig zum Auftragsbeginn geeignetes und den Vorgaben der Vergabeunterlagen entsprechendes sicherheitsüberprüftes Personal bereitzustellen.
Diese konkreten Anhaltspunkte hätte der Auftraggeber zum Anlass einer Überprüfung nehmen müssen. Unter diesen Umständen sei es vergaberechtswidrig, weiterhin auf die Leistungsfähigkeit zu vertrauen. Aufhänger für die Prüfung war im Fall vor dem OLG Düsseldorf § 124 Abs. 1 Nr. 9 c) GWB: Der Auftraggeber hätte überprüfen müssen, ob der Bieter billigend in Kauf genommen hat (Vorsatz) oder bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können (Fahrlässigkeit), dass er sein Leistungsversprechen nicht wie angeboten wird erfüllen können. Denn eine solche irreführende Information über das Leistungsversprechen ist geeignet, die Vergabeentscheidung des Auftraggebers erheblich zu beeinflussen. Liegt der Tatbestand des § 124 Abs. 1 Nr. 9 c) GWB vor, ist das Angebot des Bieters im Wege einer Ermessensreduzierung auf null auszuschließen. Eine Überprüfung des Leistungsversprechens, insbesondere in der Hinsicht, ob ausreichend Zeit bis zum Leistungsbeginn bestünde, sicherheitsüberprüftes Personal bereitstellen zu können, hat der Auftraggeber jedoch selbst nach Rüge vergaberechtswidrig versäumt.
Dies leitet zu der Frage über, welche Anforderungen an die Art und Weise der Überprüfung an das Leistungsversprechen zu stellen sind. Grundsätzlich steht dies dem Auftraggeber frei, solange das gewählte Mittel zur Überprüfung geeignet und die Mittelauswahl frei von sachwidrigen Erwägungen getroffen wurde.
Im Lichte der Entscheidung vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht (BayObLG, Beschluss vom 29.5.2024 – Verg 16/23 e) sind die Anforderungen an die Überprüfung des Leistungsversprechens nicht zu überspannen. Gegenstand des Vergabeverfahrens waren Cateringleistungen. Hinsichtlich der Qualität der Leistung bestehen eine Reihe von DIN-Vorschriften und vergleichbaren Vorgaben des Cateringgewerbes, die von Bietern einzuhalten waren. Es wurde gerügt, dass der für den Zuschlag vorgesehene Bieter durch das mit dem Angebot abgegebene Konzept („Fahrzeit gleich Garzeit“) nicht in der Lage sei, die erforderlichen DIN-Vorgaben und Anforderungen der Lebensmittelsicherheit einzuhalten. Der Auftraggeber überprüfte die Leistungsfähigkeit des für den Zuschlag vorgesehenen Bieters und ließ sich eine Bescheinigung einer Prüfungsgesellschaft und zweier Landratsämter vorlegen, die die Leistungsfähigkeit bestätigten. Nach Ansicht des BayObLG genügte dies den Anforderungen an ein geeignetes Mittel zur Überprüfung. Eine völlig „lückenlose und umfassende“ Überprüfung sei nicht erforderlich (BayObLG, Beschluss vom 29.5.2024 – Verg 16/23 e, juris Rn. 148). Aus meiner Sicht leuchtet es ein, dass die Reichweite der Pflicht zur Überprüfung des Leistungsversprechens dem Auftraggeber zumutbar und angemessen sein muss. Das vom Auftraggeber gewählte Mittel zur Überprüfung muss geeignet und die Mittelauswahl frei von sachwidrigen Erwägungen getroffen worden sein (BayObLG, Beschluss vom 29.5.2024 – Verg 16/23 e, juris Rn. 148). Der Auftraggeber muss im Ergebnis von dem Leistungsversprechen überzeugt sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass Bieter nachweisen müssen, unter jedem nur denkbaren Gesichtspunkt vertrags- und gesetzeskonform leisten zu können.
Zuschlag trotz Zweifeln am Leistungsversprechen?
Ein kreativer Umgang mit Leistungsversprechen des Bieters zeigte sich in einem weiteren Fall vor dem OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 16.4.2025 – VII-Verg 35/24). Dort legte der Auftraggeber innerhalb der Zuschlagskriterien für einen ausgeschriebenen Bauauftrag fest, dass Bieter in ihrem Angebot den sogenannten Wärmedurchgangskoeffizienten, der sich auf den Energieverbrauch des Gebäudes auswirkt, für bestimmte Materialien angeben müssen. Je höher der angegebene Koeffizient, desto mehr Punkte erhält das Angebot für dieses Kriterium. Der Auftraggeber verknüpfte das Kriterium zudem mit einem sogenannten Bietungsfaktor (einer vom Bieter selbst zu bestimmenden Zahl zwischen 0 und 1). Der Bietungsfaktor sollte die subjektive Einschätzung des Bieters zum Ausdruck bringen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der angebotene Wärmedurchgangskoeffizient tatsächlich realisiert werden kann. Je unwahrscheinlicher die Realisierung, desto weniger Punkte konnte der Bieter im Ergebnis erreichen. Des Weiteren wirkte sich der Bietungsfaktor im Rahmen der Leistungserbringung aus: Stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Koeffizient nicht erreicht werden kann, erfolgt im Rahmen der Abrechnung der erbrachten Leistungen eine finanzielle Abschöpfung des erlangten (und errechenbaren) Vorteils. Die VK Bund hielt das noch für vergaberechtskonform, das OLG Düsseldorf stellte hingegen die Unzulässigkeit eines solchen Vorgehens fest. Auf alle Argumente des OLG Düsseldorf soll hier nicht eingegangen werden; eines der zentralen Argumente steht indes unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leistungsversprechen des Bieters. Gibt ein Bieter einen Bietungsfaktor unter 1 an, so bringt er damit zum Ausdruck, dass er die angebotene Leistung nicht uneingeschränkt für realisierbar hält – mit anderen Worten: Er erklärt sich nicht vollumfänglich leistungsfähig. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf dürfte der Auftraggeber sich nicht auf die selbst eingeschätzte Erfüllungswahrscheinlichkeit verlassen, sondern wäre nach den oben aufgeführten Maßstäben gehalten, die hinreichende Leistungsfähigkeit des Bieters zu verifizieren. Der Auffassung des OLG Düsseldorf ist zuzustimmen, da trotz des Abzugs bei der Vergütung des Auftragnehmers die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Angebote aufgrund des nicht vollends verbindlichen Leistungsversprechens nicht hinreichend repräsentativ erscheint und damit die Zuschlagsentscheidung zu tragen vermag.
Praxishinweis
Das einleitende Sprichwort lässt sich wie folgt auf das Vergaberecht übertragen: Vertrauen ist der Grundsatz, Kontrolle ist die Ausnahme. Liegen jedoch konkrete Anhaltspunkte vor, muss der Auftraggeber eine ihm zumutbare geeignete Überprüfung vornehmen, an deren Ende er sich von der Leistungsfähigkeit des künftigen Auftragnehmers überzeugt haben muss.
Heißt das nun, dass der Auftraggeber jeder Rüge nachgehen und zwingend in die Aufklärung der Leistungsfähigkeit des Konkurrenten einsteigen muss? Grundsätzlich nicht, denn es obliegt allein der Einschätzung des Auftraggebers, ob Zweifel an der Leistungsfähigkeit bestehen. Substantiierte Warnungen eines anderen Bieters, die Zweifel an der Leistungsfähigkeit wecken, darf der Auftraggeber gleichwohl nicht einfach in den Wind schlagen. Die Verzögerung durch eine ausreichende Überprüfung der Leistungsfähigkeit ist allemal einem Nachprüfungsverfahren oder gar einem nicht leistungsfähigen Auftragnehmer vorzuziehen.
Schon im Vorfeld des Ausschreibungsbeginns, sind Überlegungen anzustellen, wie wesentliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit überprüft werden können. Falls die Überprüfung notwendig wird, kann dann schnell zum geeigneten Mittel zur Überprüfung gegriffen werden.
Eine Weichenstellung, etwaige Zweifel ausräumen zu können, liegt insbesondere in der Gestaltung der Vergabeunterlagen (siehe z.B. zur Gestaltung von Referenzanforderungen: Vergabeblog.de vom 27/09/2021 Nr. 48007). Ohnehin gilt dabei das Gebot, klar und eindeutig zu formulieren. Vor diesem Hintergrund dürften Auftraggeber gut beraten sein, möglichst solche Zuschlagskriterien festzulegen, die in gewisser Weise auf Plausibilität überprüft werden können. Bereits im Vorfeld sollte analysiert werden, ob Teststellungen oder ähnliche Überprüfungen sinnvoll im Vergabeverfahren durchgeführt werden können. Eine lückenlose Prüfung ist weder erforderlich noch möglich, weshalb vertragliche Mechanismen sinnvoll sind, um sich gegen unerfüllte Leistungsversprechen abzusichern. In Anbetracht der Entscheidung des OLG Düsseldorf darf aber über unvollständig erklärte Leistungsversprechen im Vergabeverfahren nicht hinweggesehen werden, selbst wenn diese auf Vertragsebene ausgeglichen werden können.
Für Unternehmen können unerfüllbare Leistungsversprechen gravierende Folgen haben: Ein Ausschluss nach § 124 GWB hat nicht nur Folgen für das konkrete Vergabeverfahren, sondern kann zu einem generellen Ausschluss von der Teilnahme an Vergabeverfahren für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren führen. Neben dem Vergaberecht kommen zudem wettbewerbsrechtliche Abmahnungen oder der Widerruf technischer Zulassungen in Betracht.
Sowohl von Auftraggebern als auch von Bietern ist zu beachten: In der Regel bedeutet das Leistungsversprechen, zum Vertragsbeginn wie gefordert und angeboten leistungsfähig zu sein. Jedenfalls bevor ein Nachprüfungsantrag gestellt wird, sollte geprüft werden, ob der Konkurrent die Leistung bereits mit dem Angebot vorhalten muss, oder ob es ausreichend und möglich ist, bis zum Vertragsbeginn leistungsbereit zu sein.
Felix Schwarz
Felix Schwarz ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht in der Sozietät BHO Legal in Köln. Er ist spezialisiert auf Vergabe-, Vertrags- und IT-Recht und berät hierin Auftraggeber- und Bieterseite. Ein Schwerpunkt bildet die Beratung in den Sektoren Hochtechnologie, Luft- und Weltraum. Herr Schwarz ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und führt regelmäßig Schulungen durch.


 (24 Bewertungen, durchschn.: 4,83aus 5)
(24 Bewertungen, durchschn.: 4,83aus 5)








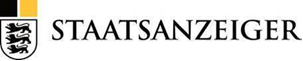
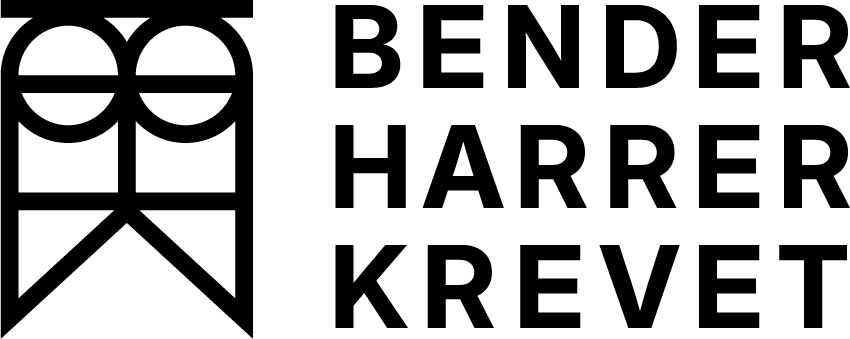
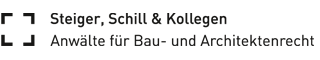
Schreibe einen Kommentar