 Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 verändert sich die vergaberechtliche Landschaft in Nordrhein-Westfalen grundlegend. Durch die Einführung des neuen § 75a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) fallen sämtliche landesrechtlichen Wertgrenzen für kommunale Vergabeverfahren weg. An die Stelle der bisherigen Pflicht zur Anwendung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A, Abschnitt 1) tritt ein allgemeiner Grundsatzrahmen. Kommunen sind damit im Unterschwellenbereich künftig nicht mehr durch bundesrechtlich überformte Detailregelwerke gebunden, sondern müssen ihre Vergaben auf Grundlage weniger, abstrakter Leitprinzipien organisieren. Die Neuregelung bedeutet für die Praxis einen tiefen Einschnitt: Während sich öffentliche Auftraggeber bisher an bekannten und eingeübten Verfahren orientieren konnten, müssen sie sich nun entscheiden, ob sie diesen Rahmen verlassen oder durch Satzungsrecht wiederherstellen wollen.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 verändert sich die vergaberechtliche Landschaft in Nordrhein-Westfalen grundlegend. Durch die Einführung des neuen § 75a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) fallen sämtliche landesrechtlichen Wertgrenzen für kommunale Vergabeverfahren weg. An die Stelle der bisherigen Pflicht zur Anwendung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A, Abschnitt 1) tritt ein allgemeiner Grundsatzrahmen. Kommunen sind damit im Unterschwellenbereich künftig nicht mehr durch bundesrechtlich überformte Detailregelwerke gebunden, sondern müssen ihre Vergaben auf Grundlage weniger, abstrakter Leitprinzipien organisieren. Die Neuregelung bedeutet für die Praxis einen tiefen Einschnitt: Während sich öffentliche Auftraggeber bisher an bekannten und eingeübten Verfahren orientieren konnten, müssen sie sich nun entscheiden, ob sie diesen Rahmen verlassen oder durch Satzungsrecht wiederherstellen wollen.
Dieser Beitrag zeichnet die neue Rechtslage nach, stellt die Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbände vor und beleuchtet die damit verbundenen Chancen und Risiken. Dabei wird auch die besondere zeitliche Konstellation nach den Kommunalwahlen in NRW berücksichtigt. Denn mit der Konstituierung der neuen Räte und Ausschüsse ist es für viele Kommunen kaum möglich, noch vor dem Inkrafttreten des § 75a ein eigenes Vergaberegime zu beschließen. Das führt zu einer Übergangsphase, die von erheblicher Rechtsunsicherheit geprägt ist.
1. Der neue § 75a GO NRW im Wortlaut
Die zentrale Vorschrift lautet:
§ 75a Allgemeine Vergabegrundsätze
(1) Die Gemeinde hat die Vergabe von öffentlichen Aufträgen vorbehaltlich anderweitiger Rechtsvorschriften wirtschaftlich, effizient und sparsam unter Beachtung der Grundsätze von Gleichbehandlung und Transparenz zu gestalten. Dies gilt auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer unterhalb der jeweils geltenden Schwellenwerte nach § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245) in der jeweils geltenden Fassung liegt. Die Geltung höherrangiger Vorschriften sowie der Vorschriften für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert die in Satz 2 genannten Schwellenwerte erreicht, bleibt unberührt.
(2) Die Gemeinde darf Regelungen, die die Durchführung von Vergaben einschränken, nur durch den Beschluss einer Satzung erlassen.
Damit definiert das Gesetz fünf Grundprinzipien – Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Sparsamkeit, Transparenz und Gleichbehandlung – als verbindliche Vorgaben für alle Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte. Diese Prinzipien sind nicht neu, sie ergeben sich bereits aus § 75 GO NRW (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) sowie aus Art. 3 Abs. 1 GG. Neu ist jedoch, dass sie im Unterschwellenbereich alleinige Rechtsgrundlage werden. Die bekannten Strukturen der UVgO und VOB/A gelten nicht mehr. Das bedeutet einerseits mehr Freiheit, andererseits auch mehr Unsicherheit.
Besonders einschneidend ist Absatz 2: Jede weitergehende Einschränkung oder Konkretisierung – also insbesondere jede Vorgabe zur Wahl der Vergabeart, zur Zahl der zu beteiligenden Unternehmen oder zu Verfahrensschritten – darf künftig ausschließlich durch eine kommunale Satzung erfolgen. Damit werden die bisher in § 26 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO NRW) geregelten Vergabegrundsätze vollständig aufgehoben. Die kommunale Ebene muss selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang sie neue Vorgaben einführt.
2. Die Gesetzesbegründung: Zurück auf „Null“
Die Gesetzesbegründung verdeutlicht, dass es sich nicht um eine bloße Deregulierung handelt, sondern um einen bewussten Systemwechsel. Dort heißt es: Mit der Schaffung des § 75a werden bisher bestehende kommunale Regelungen über die Durchführung von Vergaben auf „Null“ gestellt (Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 18/13836, S. 146). Das bedeutet: UVgO und VOB/A Abschnitt 1 verlieren ihre Bindungswirkung vollständig, sofern sie nicht durch eine Satzung reaktiviert oder in Bezug genommen werden. Kommunen, die untätig bleiben, dürfen sich nicht mehr auf die Fortgeltung der alten Regelwerke berufen.
Der Gesetzgeber verfolgt damit ein doppeltes Ziel. Zum einen soll die kommunale Vergabe von unnötiger Bürokratie entlastet werden. Zum anderen sollen die Räte ausdrücklich in die Pflicht genommen werden, durch Satzungsbeschlüsse bewusst über die Ausgestaltung des eigenen Vergaberechts zu entscheiden. Damit verlagert sich die Verantwortung für den Umgang mit Unterschwellenvergaben auf die kommunale Ebene – ein Schritt, der politisch gewollt ist, aber erhebliche praktische Herausforderungen mit sich bringt.
3. Die Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbände
Um den Kommunen eine Orientierung zu geben, haben die kommunalen Spitzenverbände in NRW – Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund – gemeinsam eine Mustersatzung erarbeitet. Sie wurde im September 2025 auf dem 18. NRW-E-Vergabetag vorgestellt. Nach den begleitenden Erläuterungen versteht sich die Mustersatzung als Handlungsmöglichkeit, nicht als zwingende Vorgabe. Jede Kommune kann sie übernehmen, anpassen oder durch eigene Regelungen ersetzen.
Die Mustersatzung orientiert sich sprachlich und systematisch stark an den bekannten Strukturen der UVgO und der VOB/A. Ziel war es, die bewährten Verfahren in einer verschlankten Form fortzuführen und damit Kontinuität zu sichern. Gleichzeitig enthält die Mustersatzung Öffnungsklauseln und Erleichterungen, die den Kommunen flexiblere Verfahren ermöglichen sollen. Besonders betont wird, dass es sich nicht um ein starres Modell handelt: Abweichungen in einzelnen Punkten oder eine gänzlich andere Ausgestaltung sind ausdrücklich zulässig.
Nach den Erläuterungen soll die Mustersatzung zwei Hauptfunktionen erfüllen. Zum einen soll sie den Verwaltungen Rechtssicherheit geben, indem sie die bekannten vergaberechtlichen Grundbegriffe fortführt. Zum anderen soll sie den Räten eine Entscheidungsgrundlage bieten, um bewusst über das gewünschte Anforderungsniveau zu befinden. Sie ist damit weniger eine verbindliche Vorgabe als vielmehr ein Werkzeugkasten, den Kommunen nutzen können, um schnell und praktikabel eigene Satzungsregelungen zu beschließen.
Mustersatzung versus UVgO und VOB/A – ein systematischer Vergleich
Auf den ersten Blick wirkt die Mustersatzung vertraut: Viele ihrer Regelungen lehnen sich sprachlich und systematisch eng an die bisherigen bundesrechtlichen Vorgaben an. Auf den zweiten Blick treten jedoch gravierende Unterschiede zutage, die zeigen, dass es sich um ein neues, eigenständiges Regelungsregime handelt.
Begriffsbestimmungen und Anwendungsbereich
Die Mustersatzung definiert Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge (§ 2 Abs. 2) in einer Formulierung, die sich unmittelbar an die bekannte Systematik aus UVgO und VOB/A anlehnt. Damit wird die vertraute Begriffswelt fortgeführt, sodass Vergabestellen sich nicht umstellen müssen. Zugleich wird aber der Geltungsbereich der Satzung enger gezogen: Eigenbetriebe und kommunalbeherrschte juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts sind ausdrücklich ausgenommen (§ 1 Abs. 3). Damit trägt die Mustersatzung der neuen Gesetzeslage Rechnung, wonach auch kommunale Unternehmen von der Pflicht zur Anwendung der Verfahrensordnungen befreit sind.
Vergabearten
Die Parallelen sind hier am deutlichsten. Öffentliche Ausschreibung, Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergabe sind nahezu wortgleich mit den Kategorien der VOB/A (§ 3) und der UVgO (§ 8 ff.) übernommen (§ 5 Abs. 2 Mustersatzung). Neu ist jedoch, dass die Auswahl der Vergabeart vollständig in das Ermessen der Kommune gestellt wird: „Das Vergabeverfahren kann frei gewählt werden.“ Damit verabschiedet sich die Mustersatzung vom traditionellen Leitbild der VOB/A, die die öffentliche Ausschreibung als Regelverfahren vorsah. Die Mustersatzung kehrt dieses Verhältnis um: Sie gibt keine Rangordnung mehr vor, sondern erlaubt den Kommunen, nach Belieben zu entscheiden. Dies ist der Kern der neuen Freiheit – und zugleich der Punkt, an dem die Orientierungskraft der alten Regelwerke verloren geht.
Direktaufträge und Wertgrenzen
Einer der gravierendsten Unterschiede betrifft die Wertgrenzen. Die UVgO und die VOB/A enthielten – auch über ihre Anwendungserlasse – detaillierte Vorgaben, bis zu welchen Auftragswerten Direktvergaben oder beschränkte Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb zulässig waren. Diese einheitlichen Grenzen entfallen mit § 75a GO NRW. Die Mustersatzung sieht zwar weiterhin Wertgrenzen für Direktaufträge vor (§ 5 Abs. 1), doch deren Höhe ist nicht landesrechtlich vorgegeben, sondern muss von jeder Kommune selbst politisch festgelegt werden. Damit endet die bisherige Einheitlichkeit: Wo bislang für alle Kommunen dieselben Beträge galten, wird es künftig einen Flickenteppich unterschiedlicher Wertgrenzen geben.
Dokumentationspflichten
Auch bei der Dokumentation zeigt sich ein Wechsel. Die Mustersatzung verlangt eine „fortlaufende Dokumentation in Textform“ (§ 4 Abs. 1), die an die Vorschriften der UVgO (§ 6) und der VOB/A (§ 20) erinnert. Sie verzichtet aber auf die detailreichen Vorgaben zu Inhalt, Umfang und Prüfbarkeit. Wo UVgO und VOB/A ein engmaschiges Netz an Anforderungen kannten, begnügt sich die Mustersatzung mit einer Generalklausel. Die Erläuterungen heben hervor, dass dies bewusst so gehalten ist, um Bürokratie abzubauen. Für die Praxis bedeutet das mehr Flexibilität – aber auch größere Rechtsunsicherheit, weil Maßstäbe für die „ausreichende“ Dokumentation fehlen.
Eignung und Ausschluss
Die Mustersatzung verweist bei Eignungsanforderungen und Ausschlussgründen ausdrücklich auf die §§ 123, 124 GWB (§ 7). Damit bleibt der Schulterschluss mit dem Oberschwellenrecht gewahrt. Anders als die UVgO (§ 31 ff.) und die VOB/A (§ 6a/b) enthält die Mustersatzung aber keine ausgefeilte Systematik zur Nachforderung, Prüfung und Wertung der Nachweise. Sie beschränkt sich auf die Grundsätze: Eigenerklärungen sollen genügen, vertiefte Nachweise können nur von aussichtsreichen Bietern verlangt werden. Für die Verwaltungspraxis bedeutet dies eine Vereinfachung, zugleich aber auch den Verlust der klaren Leitplanken, die bislang Sicherheit gaben.
Zuschlagskriterien
Beim Zuschlag knüpft die Mustersatzung an die bekannte Formel an: Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot (§ 9 Abs. 4). Qualität, Nachhaltigkeit, Zweckmäßigkeit und Preis werden ausdrücklich genannt – fast wortgleich zu den bisherigen Vorgaben in UVgO (§ 43) und VOB/A (§ 16d). Neu ist jedoch, dass die Mustersatzung auch hier keine weiteren Konkretisierungen vorsieht. Die Gewichtung, die Mindestanforderungen, die Bewertungsmethoden: all dies ist nun Sache der Kommune. Während die UVgO und die VOB/A hier eine gewisse Struktur vorgaben, verzichtet die Mustersatzung bewusst darauf, um Gestaltungsfreiheit zu eröffnen.
Fristen und Verfahrenstransparenz
Die Mustersatzung gibt keine festen Fristen mehr vor, sondern verlangt lediglich eine „angemessene“ Fristsetzung (§ 10). Auch die Regeln zur Angebotsöffnung (§ 12) sind stark reduziert: Es genügt eine Niederschrift, in der die beiden Vertreter des Auftraggebers benannt werden. Die minutiösen Vorgaben der VOB/A (§§ 14,14a) entfallen. Damit wird das Verfahren schlanker, zugleich aber auch anfälliger für Vorwürfe der Intransparenz.
Zusatzregelungen und Flexibilität
Ein besonderes Merkmal der Mustersatzung ist die Offenheit für zusätzliche Regelungen. Die Erläuterungen verweisen ausdrücklich darauf, dass etwa die Einbindung zentraler Vergabestellen oder die Beteiligung der Rechnungsprüfung nach § 104 GO NRW ergänzt werden können. Solche Optionen gab es in der UVgO und VOB/A nicht. Das macht die Mustersatzung flexibler – birgt aber auch die Gefahr, dass Kommunen durch zusätzliche Vorgaben den Bürokratieabbau wieder konterkarieren.
Gesamtbewertung der Mustersatzung
Im direkten Vergleich wird deutlich: Die Mustersatzung ist keine bloße Fortschreibung der UVgO und VOB/A, sondern ein eigenständiges Instrument. Sie bewahrt bewusst die vertraute Sprache und die bekannten Strukturen, um den Kommunen Sicherheit im Umgang zu geben. Sie löst sich aber von deren detaillierten, verbindlichen Vorgaben und ersetzt sie durch Generalklauseln und Ermessensspielräume.
Die Parallelen sind deshalb mehr Schein als Sein: Sie dienen der Kontinuität, nicht der Fortgeltung. In der Substanz eröffnet die Mustersatzung den Kommunen einen weiten Handlungsspielraum – zugleich aber auch neue Unsicherheiten. Ob sie in der Praxis Bürokratie abbaut oder eher neue Komplexität erzeugt, wird entscheidend davon abhängen, wie die einzelnen Kommunen ihre Satzung beschließen und auslegen.
4. Praktische Implikationen für die Kommunen
Die praktische Herausforderung liegt auf der Hand: Zum 1. Januar 2026 tritt § 75a in Kraft. Bis dahin müssen Kommunen entscheiden, ob sie eine Vergabesatzung erlassen. Angesichts der gerade erst konstituierten Räte und Ausschüsse ist es jedoch unwahrscheinlich, dass flächendeckend bis zum Jahreswechsel Satzungen verabschiedet werden. Das bedeutet: Viele Kommunen werden zum Stichtag ohne konkrete Regelungen dastehen.
In diesem Fall gilt unmittelbar nur der abstrakte Grundsatzrahmen des § 75a. Kommunen dürfen ihre Vergaben dann nicht mehr nach UVgO oder VOB/A durchführen, es sei denn, sie haben diese ausdrücklich in eine Satzung übernommen. Praktisch bedeutet das, dass die bekannten Verfahrensarten, Wertgrenzen und Dokumentationspflichten nicht mehr verbindlich sind. Ob etwa bei einer Beschränkten Ausschreibung mehrere Unternehmen beteiligt werden müssen oder ob eine Freihändige Vergabe zulässig ist, ergibt sich allein aus den allgemeinen Grundsätzen von Transparenz und Gleichbehandlung. Das erhöht den Entscheidungsspielraum der Verwaltung erheblich, birgt aber auch Rechtsrisiken.
Die Mustersatzung bietet hier einen Ausweg. Wer sie beschließt, schafft sich wieder ein verlässliches Regelwerk. Allerdings handelt es sich um ein neues, noch nicht praxiserprobtes Modell. Ob es sich in der täglichen Arbeit bewährt, ist offen. Damit stehen die Kommunen vor einer schwierigen Wahl: Entweder sie riskieren die völlige Deregulierung mit den damit verbundenen Unsicherheiten oder sie übernehmen eine Mustersatzung, deren praktische Tauglichkeit erst noch unter Beweis gestellt werden muss.
5. Übergangsstrategien
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach Übergangsstrategien. Kommunen, die kurzfristig keine Satzung beschließen können, müssen dennoch handlungsfähig bleiben. Sie können ihre Vergaben zwar nach den allgemeinen Grundsätzen durchführen, sollten dabei aber dokumentieren, warum das gewählte Verfahren diese Grundsätze wahrt. Denkbar ist, sich dabei faktisch an den bekannten Strukturen der UVgO und VOB/A zu orientieren – allerdings ohne diese als verbindliches Recht auszugeben.
Eine weitere Option ist es, die Mustersatzung zunächst im Kern zu übernehmen und später anzupassen. So ließe sich ein Mindestmaß an Rechtssicherheit schnell herstellen, ohne die politischen Diskussionen zu überlasten. Sobald mehr Erfahrungen mit der neuen Rechtslage vorliegen, kann die Satzung nachjustiert werden.
Langfristig stellt sich die Frage, ob Kommunen die Chance nutzen, ihre Vergabeprozesse schlanker und flexibler zu gestalten. Der Wegfall der UVgO und VOB/A eröffnet die Möglichkeit, Verfahren stärker an den konkreten Bedürfnissen der Kommune auszurichten. Das setzt jedoch voraus, dass die Verwaltung in der Lage ist, auf Grundlage der abstrakten Grundsätze verlässliche Verfahren zu entwickeln und umzusetzen.
6. Bewertung und Ausblick
Der neue § 75a GO NRW ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Er bietet die Chance, Bürokratie abzubauen und die kommunale Vergabe zu flexibilisieren. Gleichzeitig schafft er aber erhebliche Rechtsunsicherheit. Für die Praxis wird entscheidend sein, wie viele Kommunen von der Möglichkeit Gebrauch machen, eigene Vergabesatzungen zu erlassen, und in welcher Form dies geschieht.
Die Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbände ist ein erster Schritt, um Orientierung zu geben. Sie dürfte in vielen Kommunen als Grundlage dienen. Ob sie sich bewährt, wird sich erst in der Praxis zeigen. Klar ist aber schon jetzt: Die Zeit bis zum 1. Januar 2026 ist kurz. Wer bis dahin keine Satzung beschließt, muss sich auf eine Übergangsphase mit unklaren Rechtsgrundlagen einstellen.
Für die Vergabepraxis bedeutet das: Kommunen sollten umgehend prüfen, ob sie eine Vergabesatzung erlassen wollen, und – falls ja – ob sie die Mustersatzung übernehmen oder ein eigenes Modell entwickeln. Parallel dazu sollten sie ihre Verwaltungen auf die neuen Anforderungen vorbereiten und sicherstellen, dass Vergaben auch ohne die bisherigen Detailregelwerke rechtssicher durchgeführt werden können.
Anmerkung der Redaktion
 Herzliche Einladung im Namen des Autors und Regionalgruppenvorsitzenden Dr. Christian Teuber zur 5. Sitzung der DVNW Regionalgruppe Dortmund. Die Sitzung findet am 5. November 2025 vor Ort in Dortmund statt. Gegenstand der Sitzung wird der Inhalt dieses Beitrags: § 75a GO NRW und die Mustersatzung NRW.
Herzliche Einladung im Namen des Autors und Regionalgruppenvorsitzenden Dr. Christian Teuber zur 5. Sitzung der DVNW Regionalgruppe Dortmund. Die Sitzung findet am 5. November 2025 vor Ort in Dortmund statt. Gegenstand der Sitzung wird der Inhalt dieses Beitrags: § 75a GO NRW und die Mustersatzung NRW.
Eine kostenfreie Anmeldung ist innerhalb der Regionalgruppe im Deutschen Vergabenetzwerk (DVNW) möglich.
Noch kein Mitglied im DVNW? Dann geht es hier zur Mitgliedschaft.
Dr. Christian Teuber
Dr. Christian Teuber ist Partner bei Baker Tilly und leitet dort den Bereich Vergaberecht. Seit rund 20 Jahren berät er öffentliche Auftraggeber bei komplexen Ausschreibungen, Infrastruktur-, IT- und Beschaffungsprojekten. Sein Schwerpunkt liegt auf der strategischen und rechtssicheren Gestaltung von Vergabeverfahren, die den hohen Anforderungen der Praxis sowie der Kontrolle durch Vergabenachprüfungsinstanzen standhalten. Er vertritt Auftraggeber und Unternehmen regelmäßig in Nachprüfungsverfahren vor Vergabekammern und Oberlandesgerichten und verfügt über besondere Expertise an den Schnittstellen zum Beihilfe-, Zuwendungs- und Haushaltsrecht. Als Speaker und Ausbilder im Fachanwaltslehrgang Vergaberecht prägt er die nächste Juristengeneration; zudem leitet er die Regionalgruppe Dortmund des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW).


 (8 Bewertungen, durchschn.: 4,63aus 5)
(8 Bewertungen, durchschn.: 4,63aus 5)








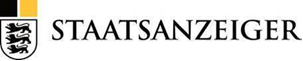
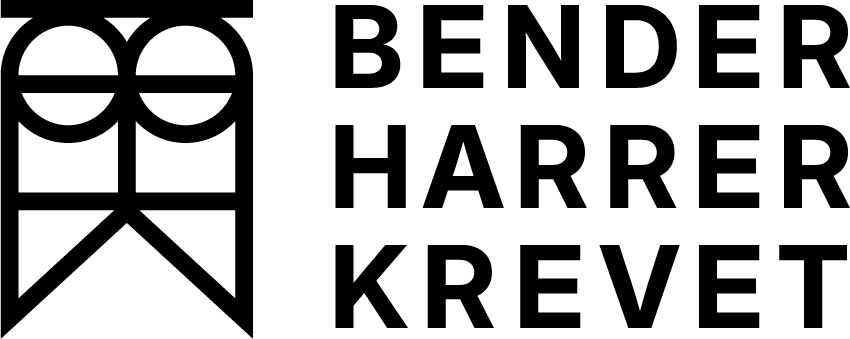
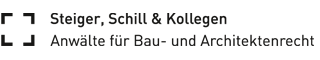
Schreibe einen Kommentar