 Bei Bauvergaben der öffentlichen Hand zeichnet sich zunehmend ein Trend zur gesamthaften Vergabe von Planungs- und Bauleistungen aus einer Hand ab. Die sog. Totalunternehmervergabe bietet gegenüber der klassischen Ausschreibung in vielen Einzelgewerken oft zahlreiche Vorteile, insbesondere eine hohe Kosten- und Terminsicherheit. Auch ist es möglich, über ein sog. Zwei-Umschlag-Verfahren Elemente eines Architektenwettbewerbs in die Vergabe zu integrieren.
Bei Bauvergaben der öffentlichen Hand zeichnet sich zunehmend ein Trend zur gesamthaften Vergabe von Planungs- und Bauleistungen aus einer Hand ab. Die sog. Totalunternehmervergabe bietet gegenüber der klassischen Ausschreibung in vielen Einzelgewerken oft zahlreiche Vorteile, insbesondere eine hohe Kosten- und Terminsicherheit. Auch ist es möglich, über ein sog. Zwei-Umschlag-Verfahren Elemente eines Architektenwettbewerbs in die Vergabe zu integrieren.
Notwendig ist dafür eine sog. funktionale Leistungsbeschreibung. Als Hemmnis wird jedoch derzeit oft eine spezifisch deutsche Vorschrift angesehen, die noch aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Gemäß § 7c (EU) VOB/A sind funktionale Leistungsbeschreibungen (sog. Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm) nur im Ausnahmefall zulässig, in der Regel sollen öffentliche Auftraggeber Leistungsverzeichnisse erstellen.
Doch eine aktuelle Entscheidung des EuGH lässt erkennen: diese Vorschrift dürfte nicht vereinbar mit EU-Vergaberecht sein.
Art. 42 Abs. 3 RL 2014/24/EU
Leitsatz
1. Es besteht keine Hierarchie zwischen den in Art. 42 Abs. 3 Buchst. a bis d aufgezählten Methoden der Formulierung der technischen Spezifikationen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, Rn. 26 und 28).
2. Art. 42 Abs. 3 der Richtlinie 2014/24/EU (…) ist dahin auszulegen, dass die in dieser Bestimmung enthaltene Aufzählung der Methoden der Formulierung technischer Spezifikationen abschließend ist – unbeschadet mit dem Unionsrecht vereinbarer zwingender nationaler technischer Vorschriften im Sinne dieser Bestimmung und unbeschadet von Art. 42 Abs. 4 dieser Richtlinie.*)
3. Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie 2014/24 ist dahin auszulegen, dass die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung, Wirtschaftsteilnehmern den gleichen Zugang zu den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu gewähren, und das ebenfalls darin enthaltene Verbot, die Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb in ungerechtfertigter Weise zu behindern, zwangsläufig verletzt werden, wenn ein öffentlicher Auftraggeber durch eine technische Spezifikation, die nicht mit den Regeln in Art. 42 Abs. 3 und 4 dieser Richtlinie vereinbar ist, bestimmte Unternehmen oder bestimmte Waren ausschließt.
Sachverhalt
In dem entschiedenen Fall ging es um den Bau bzw. die Erneuerung von Abwasserkanälen. Der belgische Auftraggeber hatte allein die Verwendung von Rohren aus Steinzeug zugelassen. Ein Bieter wollte Kunststoffrohre verwenden und griff diese Vorgabe an. Das belgische Gericht meinte, dass die Vorgabe schon grundsätzlich nicht durch die Möglichkeiten, eine Leistung zu beschreiben, gedeckt sei, die in der Vergaberichtlinie geregelt sind, und legte dem EuGH dazu verschiedene Fragen vor.
Die Entscheidung
Keine Hierarchie zwischen funktionaler Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis
Der EuGH betonte zunächst, dass es zwischen den Methoden der Leistungsbeschreibung, die Art. Art. 42 Abs. 3 RL 2014/24/EU regelt, keine Hierarchie gibt (Rn. 29). Dies gilt insbesondere für die Leistungsbeschreibung mittels Leistungs- und Funktionsanforderung einerseits und derjenigen mittels technischer Spezifikationen andererseits. Der Gerichtshof stellte sodann klar, dass diese Vorschrift die Methoden der Leistungsbeschreibung abschließend regelt und Auftraggeber unbeschadet zwingender abweichender technischer nationaler Vorschriften – auch dazu verpflichtet sind, die Leistung mittels dieser Methoden zu beschreiben (Rn. 36).
Bei konkreten Produktvorgaben: Rechtfertigung erforderlich
Im entschiedenen Fall war die Anforderung an das Material keine Leistungs- und Funktionsanforderung (vgl. Rn. 56). Es handelte sich um eine Produktvorgabe, die gemäß Art. 42 Abs. 4 RL 2024/EU gerechtfertigt sein müsse (Rn. 57).
Rechtliche Würdigung
Der im deutschen § 7c EU Abs. 1 VOB/A vorgesehene, grundsätzliche Vorrang des Leistungsverzeichnisses gegenüber der funktionalen Leistungsbeschreibung (Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm) dürfte nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH kaum haltbar sein. Einen Vorrang der funktionalen Leistungsbeschreibung gegenüber einem Leistungsverzeichnis darf es demnach gerade nicht geben. Auch andere aktuelle Entscheidungen weisen in diese Richtung (vgl. VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 16.04.2024, AZ.: 1 VK 10/24).
Dr. Valeska Pfarr, MLE
Die Autorin Dr. Valeska Pfarr, MLE, ist Rechtsanwältin bei Menold Bezler Rechtsanwälte, Stuttgart. Sie ist auf das Vergaberecht spezialisiert, ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Beratung der öffentlichen Hand.












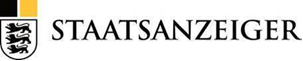
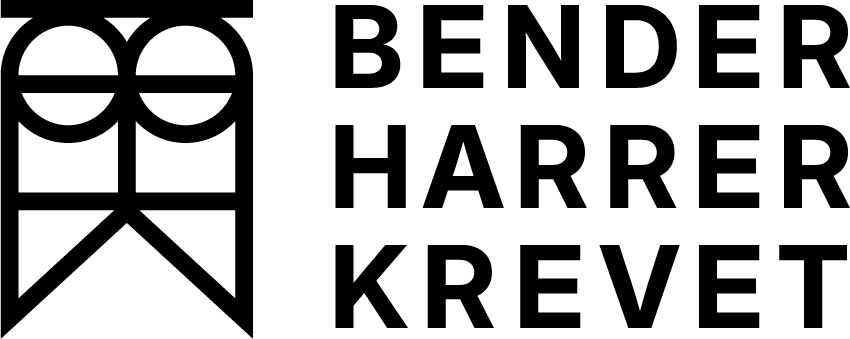
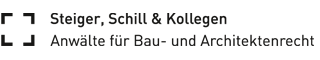
Schreibe einen Kommentar