Der Corona-Aufbaufonds der EU – die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) – hat Schwachstellen bei Leistung, Rechenschaftspflicht und Transparenz. Darauf weist der Europäische Rechnungshof in seiner Analyse hin, in der er die zur Bewältigung der Krise gedachten Ausgaben in Höhe von 650 Milliarden Euro unter die Lupe nimmt. Auch wenn die ARF eine entscheidende Rolle bei der Erholung der EU nach der Pandemie gespielt habe, lägen kaum Informationen über die Ergebnisse und gar keine über die tatsächlichen Kosten vor. Daher sei nicht klar, was die Bürgerinnen und Bürger konkret für ihr Geld erhielten. Darauf weisen die Prüfer die politischen Entscheidungsträger in der EU hin, sollten diese erwägen, künftige Haushalte auf Leistung und nicht auf Kosten beruhen zu lassen.
Die ARF wurde 2021 zu Krisenzeiten eingerichtet. Aus ihr werden Maßnahmen – Reformen und Investitionen – in Bereichen wie dem ökologischen oder dem digitalen Wandel finanziert. Um Geld zu erhalten, müssen die EU-Länder die in ihren nationalen Plänen vorab festgelegten Etappenziele und Zielwerte erreichen. Es ist das erste Mal, dass die EU in so großem Umfang Finanzmittel einsetzt, die nicht mit Kosten verknüpft sind.
„Die politischen Entscheidungsträger der EU müssen Lehren aus der ARF ziehen und dürfen in Zukunft kein ähnliches Instrument zulassen, ohne über Informationen über die tatsächlichen Kosten, die Endempfänger und eine klare Antwort auf die Frage zu verfügen, was die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich für ihr Geld erhalten“, so Ivana Maletić, die als eines von zwei Mitgliedern des Rechnungshofs für die Analyse verantwortlich zeichnet. „Bei künftigen leistungsbasierten Haushalten muss die Finanzierung stärker an Ergebnisse geknüpft sein und auf klar definierten Regeln beruhen. Andernfalls sollte ein solches System nicht genutzt werden“, so Jorg Kristijan Petrovič, das zweite für die Analyse zuständige Mitglied.
Während die politischen Diskussionen über den langfristigen EU-Haushalt für die Zeit nach 2027 laufen, weisen die Prüfer auf mehrere Probleme mit der ARF hin. Zunächst vertreten sie die Auffassung, dass es sich bei der ARF nicht wirklich um einen leistungsbasierten Finanzierungsmechanismus handelt. Faktisch werde bei der ARF das Augenmerk stärker auf Fortschritte bei der Umsetzung gelegt. Darüber hinaus könnten die Effizienz der Ausgaben und das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht ermittelt werden, da die EU-Kommission keine Daten zu den tatsächlichen Kosten erhebe und nur wenige Informationen über die Ergebnisse vorlägen.
Die Prüfer betonen, wie wichtig es sei, künftige Ausgabenprogramme so zu gestalten und durchzuführen, dass die Rechenschaftspflicht gesichert bleibe. Trotz jüngster Verbesserungen seien die Kontrollen bei der ARF nach wie vor nicht engmaschig genug. So verlasse sich die Kommission beispielsweise weitgehend darauf, dass die EU-Länder schwerwiegende Regelverstöße selbst aufdecken und beheben und die Einhaltung europäischer und nationaler Vorschriften sicherstellen. Allerdings wiesen die Systeme der EU-Länder Schwachstellen auf. Darüber hinaus könne die EU-Kommission keine Finanzkorrekturen verhängen. Beispielsweise könne sie – außer in schwerwiegenden Fällen wie Betrug – bei konkreten Verstößen gegen die Vergabevorschriften kein Geld zurückfordern. Dies bedeute, dass die EU-Kommission möglicherweise selbst im Falle von Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Zahlungen in voller Höhe leiste, solange die vereinbarten Etappenziele und Zielwerte erreicht wurden. Darüber hinaus erhielten einige EU-Länder aufgrund der Art und Weise, wie die Etappenziele und Zielwerte jeweils festgelegt wurden, beträchtliche Zahlungen, bevor sie die Projekte abschlössen. Dies stelle ein Risiko für die finanziellen Interessen der EU dar, da die Mitgliedstaaten die Gelder letztlich behalten könnten, auch ohne die Projekte zu vollenden.
Zwar gehe es mit der Umsetzung der ARF voran, doch gebe es Verzögerungen, was die Erreichung der Ziele gefährde. Tatsächlich müsse noch der Großteil der Projekte bis August 2026 umgesetzt werden. Gleichzeitig bedeute die Auszahlung von EU-Mitteln an die nationalen Haushalte nicht, dass das Geld die Endempfänger und die Realwirtschaft auch erreicht hat.
Die ARF wird fast vollständig durch Kredite finanziert. Der Kommission sei es gelungen, rasch und erfolgreich Geld für die ARF zu beschaffen. In den ersten Jahren seien dabei die Zinsen historisch niedrig gewesen. Die Zinssätze seien seither gestiegen, und die ursprünglich geschätzten Finanzierungskosten könnten sich daher bis 2026 mehr als verdoppeln. Zusätzlich zu den Tilgungszahlungen werde dies künftige EU-Haushalte erheblich unter Druck setzen. Was mögliche künftige Kreditaufnahmen betrifft, halten die Prüfer es für wichtig, dass die EU Zinsrisiken entsprechend eindämmt und im Voraus einen Kredittilgungsplan aufstellt, in dem angegeben ist, woher die Mittel kommen sollen. Dies sei bei der ARF nicht der Fall gewesen.
Hintergrundinformationen
Die ARF wurde 2021 als einmaliges befristetes Instrument eingerichtet, um die EU-Länder dabei zu unterstützen, sich von der Corona-Pandemie zu erholen und widerstandsfähige Volkswirtschaften aufzubauen. Die Fazilität dient der Finanzierung von Maßnahmen in sechs vorab festgelegten Bereichen zwischen Februar 2020, als die Pandemie begann, und August 2026, dem Jahr, in dem die Laufzeit der ARF endet. Ihr ursprüngliches Budget belief sich auf 724 Milliarden Euro, wovon die EU-Länder 650 Milliarden Euro (359 Milliarden Euro an Zuschüssen und 291 Milliarden Euro an Darlehen) in Anspruch nahmen. Die Schulden aus der ARF müssen bis 2058 von der EU-Kommission (für Zuschüsse) und von den Mitgliedstaaten (für Darlehen) zurückgezahlt werden. In der zweiten Jahreshälfte 2025 will die Kommission den nächsten Finanzrahmen für den Zeitraum nach 2027 vorlegen.
Die Analyse 02/2025 „Leistungsorientierung, Rechenschaftspflicht und Transparenz: Lehren aus den Schwachstellen der ARF“ sowie ein Kurztext mit den wichtigsten Fakten und Feststellungen sind auf der Website des Europäischen Rechnungshofs abrufbar. Darin sind die Prüfungen und Stellungnahmen des Rechnungshofs zur ARF zusammengefasst, die auch in einer speziellen Rubrik zur ARF eingesehen werden können. Im Prüfungsplan des Rechnungshofs für 2025 und 2026 sind weitere Berichte über die ARF vorgesehen, die sich auf Bereiche wie Energieeffizienz, Rückverfolgbarkeit und Betrug erstrecken.
Den Bericht des EuRH können Sie hier abrufen.
Quelle: Europäische Rechnungshof











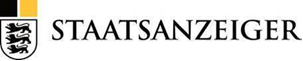
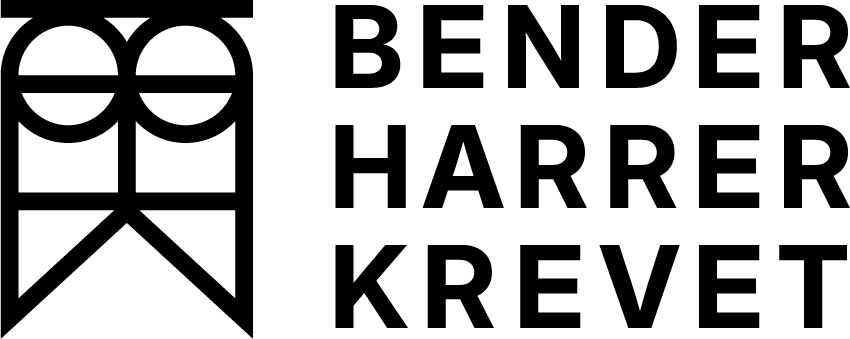
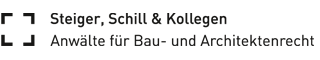
Schreibe einen Kommentar