Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD das Vergaberecht entdeckt. Ganz neu ist das nicht: Jeder Bundesregierung der letzten Legislaturen war die öffentliche Beschaffung ein Anliegen, so ist im Vergabeblog vom 23.10.2009 zum Koalitionsvertrag von CDU/ CSU und FDP zu lesen – das war vor 16 Jahren – das Vergaberecht soll „reformiert und weiter gestrafft werden“, mit dem Ziel, die „Vergaberegeln insgesamt zu vereinfachen.“ Jeder Praktiker und jede Praktikerin wissen, das Gegenteil ist eingetreten, und jede Regierung legte seitdem – unter gleicher Überschrift – eine Schippe drauf. Sicher nicht zum Nachteil einer blühenden Beratungslandschaft, wovon ich das Deutsche Vergabenetzwerk (DVNW), dass ich im Jahr 2010 aus der Notwendigkeit einer Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch heraus gründete, gar nicht ausnehmen möchte. Was also darf die Vergabe-Community diesmal erwarten? Ein Kommentar.
Nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Geht es nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, dann ist der Passus im aktuellen Koalitionsvertrag „Wir werden uns dafür einsetzen, das Vergaberecht auf nationaler und europäischer Ebene für Lieferungen und Leistungen aller Art für Bund, Länder und Kommunen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu digitalisieren“ also ein eher schlechtes Omen. Schaut man in die Details, (vgl. Vergabeblog v. 10.04.2025), so finden sich auch keine grundlegenden, systematischen Änderungen, dafür mehr Ausnahmen: Die Wertgrenzen auf Bundesebene für Direktaufträge sollen bei Liefer- und Dienstleistungen auf 50.000 €, für Start-ups mit innovativen Leistungen sogar bis 100.000 € erhöht werden. Zudem soll es sektorale Ausnahmen vom Vergaberecht geben, z.B.in Fragen der nationalen Sicherheit oder für emissionsarme Produkte. Auch soll der Rechtsschutz für Bieter im Nachprüfungsverfahren eingeschränkt werden, seine Beschwerde zum OLG soll keine aufschiebende Wirkung mehr entfalten, und somit der – u.U. rechtwidrige – Auftrag dennoch erteilt werden können. Das ist keine mutige, strukturelle Reform des Vergaberechts, sondern vielmehr ein Umschiffen vorhandener Probleme. „Für uns gilt der Grundsatz der mittelstandsfreundlichen Vergabe“ in Zeile 2061 des Koalitionsvertrages bestätigt dann auch, dass am Gebot der Vergabe von Fach- und Teillosen (§ 97 Abs. 4 GWB) wohl eher nicht gerüttelt werden soll, obwohl man hiervon zumindest bei großen Infrastrukturprojekten absehen könnte.
Viele Köche verderben den Brei
Machen wir uns ehrlich: Das Vergaberecht ist, was es ist, weil es schon lange nicht mehr nur der effizienten Beschaffung dient. Das öffentliche Auftragswesen mit geschätzten 350 Milliarden € jährlichem Beschaffungsvolumen durch Bund, Länder und Kommunen ist ein begehrter Hebel in vielen Händen: In den sog. Verdingungsausschüssen DVA (Deutscher Verdingungsausschuss für Bauleistungen) und den DVAL (Deutscher Verdingungsausschuss für Lieferleistungen und Dienstleistungen) haben die Vertreter von Auftraggeber wie -nehmerseite viele Jahre lang vor allem ihre eigenen Interessen eingebracht, was demokratietheoretisch schon immer dünnes Eis war. Zumindest der DVAL ist inzwischen abgeschafft. Nachdem die Politik die Lenkungswirkung der öffentlichen Beschaffung entdeckte, avancierten die sog. „vergabefremden Aspekte“ in den letzten 15 Jahren zum gefühlten Primärziel der Vergabe, und der Begriff deshalb zum Unwort. Als Dr. Marco Buschmann, wenige Tage nach seinem Rücktritt als Bundesjustizminister im vergangenen Jahr, bei seiner Rede auf unserem Deutschen Vergabetag von einem dringend notwendigen Rückbau derer sprach, um die Beschaffung wieder praxistauglich zu machen, gab der lautaufbrausende Applaus der fast 1000 Zuhörer, vornehmlich Beschafferinnen und Beschaffer, ihm Recht.
Zeile 2062
Vielleicht hat man diesen Applaus im nur einen Steinwurf entfernten Bundestag ja noch hören können: In Zeile 2062 bis 2063 des Koalitionsvertrages heißt es durchaus überraschend „Wir werden das Vergaberecht auf sein Ziel einer wirtschaftlichen, diskriminierungs- und korruptionsfreien Beschaffung zurückführen“. Das ist eine kleine Revolution. Man darf gespannt sein, was nach den Mühlen des politischen Bertriebs am Ende davon übrigbleiben wird, vermutlich im Kompromissreigen zwischen den Koalitionären nicht allzu viel. Aber es gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich kann und soll die Nachfragemacht der öffentlichen Hand „richtig“ eingesetzt werden, aber, um es mit den Worten eines Richters am OLG Koblenz während meiner Ausbildung zum 2. Staatsexamen zu sagen: Die Soße darf nicht teurer werden als der Braten.
Der Faktor Mensch
Womit wir bei des Pudels Kern angekommen sind: Das Recht der Vergabe muss wieder stärker an den Bedürfnissen derer ausgerichtet werden, die täglich damit arbeiten. Dafür setzt sich u.a. der Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) ein, und der muss es wissen, denn schließlich sind es die Kommunen, die den absoluten Großteil der Vergaben schultern. Den Mitarbeitenden in den Vergabestellen muss dafür zudem die notwendige Wertschätzung, das Vertrauen und, wenn erforderlich, die fachliche Qualifizierung zukommen. Wenn seitens der Politik bekundet wird, wie wichtig die öffentliche Beschaffung für das Staatswesen ist, dann muss sie auch jene verstärkt in den Blick nehmen und unterstützen, die damit betraut sind. Im Handwerk würde niemand nur auf das Werkzeug, aber nicht auch auf den Handwerker achten. Wir haben beim Deutschen Vergabenetzwerk (DVNW) im letzten Jahr erstmals einen Lehrgang für BeschafferInnen aufgesetzt – von Praktikern für Praktiker – und freuen uns über den unerwartet großen Zuspruch. Nicht zuletzt: Es braucht eine Führungskultur, die MitarbeiterInnen in Vergabestellen den Rücken stärkt.
Ja, aber…
Um aber zwei Themen, eine nötige praxiszentrierte Reform des Vergaberechts auf der einen Seite, und offenkundige Versäumnisse der letzten Jahrzehnte Land auf, Land ab, auf der anderen Seite, nicht miteinander zu verwechseln: So, wie das Vergaberecht nicht Schuld ist an maroden Brücken und Straßen, am bröckelnden Putz von Schulwänden, einer Bahn auf Glückspiel-Niveau oder einer kaum verteidigungsfähigen Bundeswehr, so wenig wird selbst „gar-kein-Vergaberecht“ daran etwas ändern.
Marco Junk
Marco Junk ist Geschäftsführer des Deutschen Vergabenetzwerks (DVNW), dass er im Jahr 2010 gemeinsam mit Dipl.-Kaufmann Martin Mündlein gründete. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen begann er seine berufliche Laufbahn im Jahr 2004 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und war danach als Bereichsleiter Vergaberecht beim Digitalverband bitkom tätig. Im Jahr 2011 leitete er die Online-Redaktion des Verlags C.H. Beck. Von 2012 bis 10/2014 war er Mitglied der Geschäftsleitung des bitkom und danach bis 10/2021 Geschäftsführer des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. Seit 2022 ist Marco Junk zudem als Leiter Regierungsbeziehungen für das europäische IT-Unternehmen Atos tätig. Seine Beiträge geben ausschließlich seine persönliche Meinung wieder.


 (10 Bewertungen, durchschn.: 4,80aus 5)
(10 Bewertungen, durchschn.: 4,80aus 5)








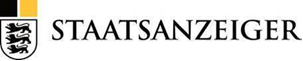
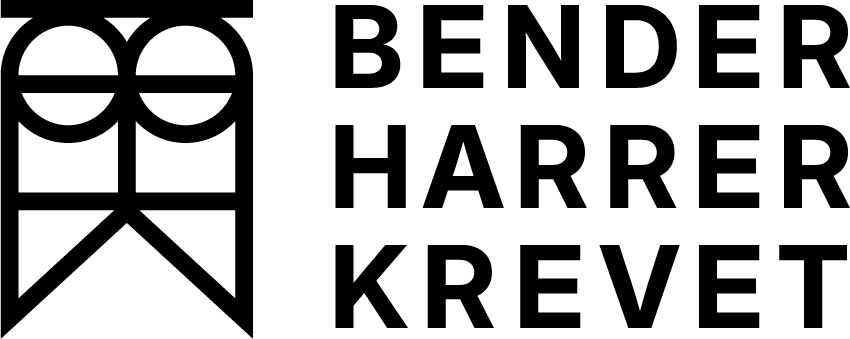
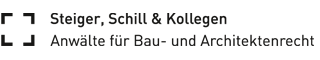
Schreibe einen Kommentar