 Die Vergabestellen leiden unter Personalmangel. Schuld ist u.a. der demographische Wandel, krankheits- und schwangerschaftsbedingte Absenzen tun ihr Übriges. Die KI nimmt einem die Abwicklung von Vergabeverfahren noch nicht ab, und so stellt sich die Frage, wie eine Entlastung der Vergabestellen eingekauft, oder ob nicht gar ein Teil ihrer Aufgaben, wenn nicht gleich die ganze Einheit, outgesourct werden kann. Das Rechtsdienstleistungsgesetz erweist sich als die schärfste Schranke solcher Outsourcing-Bemühungen, zumindest wenn sie sich an nicht-anwaltliche Dienstleister richten.
Die Vergabestellen leiden unter Personalmangel. Schuld ist u.a. der demographische Wandel, krankheits- und schwangerschaftsbedingte Absenzen tun ihr Übriges. Die KI nimmt einem die Abwicklung von Vergabeverfahren noch nicht ab, und so stellt sich die Frage, wie eine Entlastung der Vergabestellen eingekauft, oder ob nicht gar ein Teil ihrer Aufgaben, wenn nicht gleich die ganze Einheit, outgesourct werden kann. Das Rechtsdienstleistungsgesetz erweist sich als die schärfste Schranke solcher Outsourcing-Bemühungen, zumindest wenn sie sich an nicht-anwaltliche Dienstleister richten.
Der Grund ist, dass die Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren in weitem Umfang Rechtsdienstleistung sind (vgl. 1.) und Rechtsdienstleistungen nur bei Gestattung durch das Rechtsdienstleistungsgesetz oder andere Gesetze erbracht werden dürfen (vgl. 2.). Für die externe Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren bleibt somit nur der Anwalt als echter Ausweg (vgl. 3.). Den Anlass dieses Aufsatzes bildet zum einen ein deutlich zu beobachtender Anstieg bei den Vergaben von Vergabestellenleistungen, zum anderen eine rechtskräftige Entscheidung des LG Gießen, die im Beschlusswege ergangen ist und die einem Auftraggeber die Übertragung von Vergabevorbereitungs- und Vergabeabwicklungstätigkeiten auf ein Planungsbüro untersagt hat, weil diese Tätigkeiten zu wesentlichen Teilen Rechtsdienstleistungen enthielten; die Entscheidung ist in der Bibliothek im Mitgliederbereich des DVNW veröffentlicht.
1. Vergabevorbereitung und Vergabeabwicklung als Rechtsdienstleistung
Gemäß § 3 RDG ist die selbstständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in dem Umfang zulässig, in dem sie durch das Rechtsdienstleistungsgesetz oder durch oder aufgrund anderer Gesetze erlaubt wird. Danach dürfen Rechtsdienstleistungen lediglich aufgrund gesetzlicher Erlaubnis erbracht werden; im Übrigen sind sie verboten.
Eine Rechtsdienstleistung ist nach § 2 Abs. 1 RDG jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Abzustellen ist nicht auf die berufliche oder geschäftliche Gesamttätigkeit, sondern auf die im Rahmen der jeweiligen beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit erbrachte einzelne Dienstleistung.
Die Vorschrift erfasst jede konkrete Subsumtion eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen, die über eine bloß schematische Anwendung von Rechtsnormen ohne weitere rechtliche Prüfung hinausgeht. Ob es sich um einfache oder schwierige Rechtsfragen handelt, ist unerheblich (vgl. BGH GRUR 2016, 820 Rn. 43 = WRP 2016, 861 – Schadensregulierung durch Versicherungsmakler; GRUR 2016, 1189 Rn. 23 – Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur).
Rechtsdienstleistungen im Vergaberecht sind insbesondere, aber nicht ausschließlich,
- die Ermittlung der Vergabeverfahrensart,
- die Klärung der Losaufteilung,
- die Festlegung und Gewichtung von Eignungs- und Zuschlagskriterien,
- die formale Angebotsprüfung,
- die Eignungsprüfung einschließlich etwaiger Nachforderungen und
- die Fertigung von Aufklärungsschreiben
(vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25. Mai 2022 – VII-Verg 33/21, NZBau 2023, 60).
Man wird den Katalog wie folgt erweitern müssen:
- den Losverzicht prüfen und begründen,
- den Terminablauf für das Vergabeverfahren prüfen und festlegen,
- eine Vorinformation zur beabsichtigten Vergabe erstellen und veröffentlichen,
- zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen prüfen und festlegen,
- Bekanntmachungstexte erstellen und veröffentlichen,
- Vergabevermerk einschließlich Anlagen prüfen und erstellen,
- Bieterfragen und Rügen prüfen und beantworten,
- Ausschlussentscheidungen prüfen und festlegen,
- Bieter über den Ausschluss informieren,
- die Preisangemessenheitsprüfung einschließlich der Anforderung der Preisermittlungsblätter und der Preisaufklärung durchführen und dokumentieren,
- die Prüfung zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots auf Grundlage der bekanntgegebenen Zuschlagskriterien durchführen und dokumentieren,
- die Bieterinformationen nach § 134 GWB, die Zuschlagsschreiben und/oder die Aufhebungsschreiben erstellen.
Sämtliche vorgenannte Tätigkeiten erfordern es, die anwendbaren Rechtsnormen festzustellen, die Tatbestandsmerkmale auszulegen, den Sachverhalt hierunter zu subsumieren und schließlich die Rechtsfolge festzustellen und im konkreten Fall auch zu ziehen. Dies kann eher komplexe Prüfungs- und Subsumtionsleistungen beinhalte, etwa wenn die Zulässigkeit einer Produktvorgabe in einer Anlage zum Vergabevermerk begründet wird, oder aber rasch erledigt sein, z.B. wenn ein Schreiben nach § 62 Abs. 1 VgV erstellt und versendet wird.
Selbstverständlich sind auch weite Teile der Vergabeverfahrensvorbereitung Rechtsdienstleistungen. Einige der o.g. Einzeltätigkeiten werden bereits im Vorbereitungsstadium erbracht (z.B. die Losaufteilung oder die Begründung des Verzichts hierauf, die Wahl der Verfahrensart etc.). Vor allem unterfällt die Gestaltung der Vergabeunterlagen und insbesondere der Vertragsunterlagen dem Rechtsdienstleistungsbegriff des § 3 Abs. 1 RDG.
Es ist daher leichter, nach denjenigen Tätigkeiten zu fragen, die keine Rechtsdienstleistung sind. Hierzu rechnen die Markterkundung und die in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzende Bedarfsermittlung sowie – in gewissen Grenzen – die Erstellung der Leistungsbeschreibung nebst Anlagen; da letztere als Leistungssoll Vertragsbestandteil wird und zahlreichen anspruchsvollen rechtlichen Vorgaben unterliegt, ist der Übergang zur Rechtsanwendung insoweit jedoch schon fließend.
Im Vergabeverfahren trägt die fachlich-inhaltliche Richtigkeitsprüfung eher fachlich-technischen, die Wirtschaftlichkeitsprüfung des Preises eher wirtschaftlichen Charakter. Auch die Dokumentation insbesondere anspruchsvoller Wertungen auf der vierten Wertungsstufe ist eine sogar rechtlich anspruchsvolle Rechtsdienstleistung, wenn sie auch – u.U. – umfassende technische Vorarbeiten erfordern. Dies gilt gerade in Anbetracht der umfänglichen Dokumentationsrechtsprechung der Nachprüfungsinstanzen, die befolgt werden muss.
2. Gestattung durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
Rechtsdienstleistungen dürfen wie einleitend erwähnt nur erbracht werden, soweit dies erlaubt ist.
a. Keine Gestattung durch anderes Gesetz oder aufgrund eines anderen Gesetzes
Die Erbringung der unter 1. beschriebenen Leistungen nach anderen Gesetzen als dem Rechtsdienstleistungsgesetz kommt letztlich nur in Betracht, wenn in diesen anderen Gesetzen spezielle Rechtsdienstleistungsbefugnisse konkret geregelt sind, die Rechtsdienstleistungsbefugnis also schon nach dem Wortlaut der Norm für einen bestimmten Bereich oder spezielle Tätigkeiten eingeräumt wird. Dies gilt z.B. für die nach § 192 Abs. 3 VVG erlaubten Dienstleistungen der privaten Krankenversicherer für ihre Versicherungsnehmer.
Eine solche Norm ist für die Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren nicht ersichtlich. Der Begriff des Beschaffungsdienstleisters wird in den Vergaberichtlinien zwar erwähnt, dort sind jedoch ebenso wenig Rechtsdienstleistungsbefugnisse bestimmt wie in der nationalen Umsetzungsgesetzgebung.
b. Keine Gestattung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz
Einige Beschaffungsdienstleister, die von der öffentlichen Hand beherrscht werden, stützen sich noch auf § 7 RDG. Allerdings fehlt in der Regel die erforderliche satzungsrechtliche Grundlage.
Als Erlaubnistatbestand des Rechtsdienstleistungsgesetzes kommt somit allenfalls noch die Regelung über erlaubte Nebenleistungen in Betracht. Nach § 5 Abs. 1 S. 1 RDG sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Dabei ist die Frage, ob eine Nebentätigkeit vorliegt, auch nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen.
Die erste Frage lautet, welches Berufs- oder Tätigkeitsbild zugrunde zu legen ist, wie also die gerade keine Rechtsdienstleistung darstellende Haupttätigkeit zu charakterisieren ist. Das OLG Düsseldorf (Beschluss vom 25. Mai 2022 – VII-Verg 33/21, NZBau 2023, 60) hat sich bislang als einzige obergerichtliche Nachprüfungsinstanz mit dieser Frage befassen dürfen – und sie trotz ihrer Entscheidungserheblichkeit geflissentlich ignoriert. Das ist falsch, wie die wettbewerbsgerichtliche Rechtsprechung zu § 5 RDG beweist, die stets Sorgfalt darauf verwendet, das Berufs- und Tätigkeitsbild und die damit verbundenen Hauptleistungen festzustellen, bevor sie die angebliche Nebenleistung würdigt.
Die Vergabepraxis kennt – nicht abschließend – die folgenden Unternehmenstypen, die Rechtsdienstleistungen zumindest teilweise (warum auch immer) glauben, „miterbringen“ zu müssen und zu dürfen:
- Bau- und IT-Berater
- IT- und Bauprojektsteuerer
- Sonstige Beschaffungsdienstleister, z.B. nebenerwerbsselbstständige Vergabesachbearbeiter, Unternehmensberatungen etc.
- Planungsbüros, die z.B. als „Qualifizierte Vergabeberater“ agieren
- Eigengesellschaften der öffentlichen Hand, z.B. PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH
Die Dienstleister lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. In der ersten Gruppe finden sich technische und wirtschaftliche Berater, die Vergabeverfahren gleichsam „mitabwickeln“. In der Terminologie von Nicole Lieb, die soweit ersichtlich die einzige größere rechtswissenschaftliche Arbeit zu dem Problemkreis veröffentlicht hat (Lieb, Beschaffungsdienstleister im Vergabeverfahren, 2022, S. 58ff.), handelt es sich um Beratungsdienstleister, die sowohl sach- als auch vergabebezogen beraten. Hierzu gehören Bau- und IT-Berater, aber auch Projektsteuerer und oft auch Eigengesellschaften der öffentlichen Hand. Eine zweite Gruppe ist die der Projektmanager, die sekretariatsmäßig unterstützen (Lieb a.a.O. S. 62). Hierzu gehört ein Teil der sonstigen Beschaffungsdienstleister, etwa nebenerwerbsselbstständige Vergabesachbearbeiter und auch die eine oder andere rein auf den Vergabeprozess fokussierte Unternehmensberatung sowie wiederum auch Eigengesellschaften der öffentlichen Hand..
aa. Gruppe 1: die Berater
Im Einzelfall kann die Vorbereitung und Abwicklung einer Vergabe als Nebenleistung zur Hauptleistung dieser Dienstleister, etwa der Bedarfsermittlung und Erstellung einer Leistungsbeschreibung, einzustufen sein. Dazu muss zunächst ein sachlicher Zusammenhang zur Haupttätigkeit bestehen (vgl. BGH GRUR 2016, 1192 Rn. 32 – Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur). Zudem darf die Tätigkeit nicht ohne weiteres abtrennbar sein, also nicht ohne weiteres an einen Rechtsanwalt beauftragt werden können; der sachliche Zusammenhang zur Haupttätigkeit muss also auch notwendig sein (OLG Karlsruhe GRUR-RR 2025, 132 Rn. 42 und 50 – Steuerberatung beim Unternehmenskauf). Weiterhin ist entscheidend, ob dieselben Rechtskenntnisse, die für die Haupttätigkeit benötigt werden, auch für die Ausübung der Nebenleistung gebraucht werden (BGH GRUR 2016, 820 Rn. 29 – Schadensregulierung durch Versicherungsmakler).
Bereits der sachliche Zusammenhang ist oftmals fragwürdig. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich das Vorliegen der Voraussetzungen einer Nebenleistung nach § 5 Abs. 1 S. 2 RDG nach objektiven Kriterien und nicht nach der vertraglichen Vereinbarung als Haupt- oder Nebenleistung bestimmt. Der sachliche Zusammenhang kann, mit anderen Worten, nicht „herbeigeschrieben“ werden. Insoweit besteht die Haupttätigkeit eines Planers oder eines Bau- oder IT-Beraters in der Bewältigung technisch geprägter Fragestellungen. Die Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren stellen demgegenüber erhebliche Anforderungen an die Rechtsberatung. Den Maßstab des BGH zugrunde legend (vgl. BGH GRUR 2016, 1192 Rn. 32 – Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur), fehlt es somit bereits am sachlichen Zusammenhang. Im Fall von Planungsbüros hat diese Sichtweise nun auch Bestätigung des BGH-Senats für Bau- und Architektenvertragssachen erfahren. Hiernach weisen nur Rechtsdienstleistungen, die für das Erreichen der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele notwendig sind, den nötigen sachlichen Zusammenhang zur Haupttätigkeit auf (vgl. BGH ZfBR 2024, 141 Rn. 33). Dies ist bei der Vergabeabwicklung von vornherein nicht der Fall. Die HOAI gibt insoweit schon aus kompetenziellen Gründen nichts her für die Beurteilung dieser Rechtsfrage (vgl. wiederum BGH ZfBR 2024, 141 Rn. 34).
Bei IT- und Bauprojektsteuerern ist dies schwerer zu beurteilen. So ist das Schweigen der Gesetze – die AHO hat bekanntlich keine Gesetzeskraft – auch günstig für Anbieter, die gewillt sind, umfängliche Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Da es kein gesetzlich bestimmtes Bild der Hauptleistungen gibt, können auch die zur Leistungserbringung notwendigen Rechtskenntnisse nicht streng hierauf bezogen werden. Geht man von einer hergebrachten Zuständigkeit des Projektsteuerers für „Fristen, Kosten und Termine“ aus, so erschließt sich allenfalls auf den zweiten Blick, warum er auch Vergabeverfahren vorbereiten und abwickeln dürfen soll. Sicherlich benötigt er Rechtskenntnisse zu Ausführungsfristen, Vergütungsregelungen und Nachträgen, möglicherweise auch zu Versicherungen, wobei dies schon schwerer begründbar ist. Aber diese Rechtskenntnisse helfen ihm für die Vergabe nicht. Die Argumentation könnte allenfalls lauten, dass Projektsteuerer aufgrund ihrer gesamthaften, umfassenden Projektzuständigkeit nun mal auch in der Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren tätig sind, und selbstverständlich haben die Ergebnisse der Vergabeverfahren mit den Kosten des Projekts, den Fristen etc. zu tun.
Allerdings ist der Blick auf die hier behandelte Ausgangsfrage zu richten, nämlich das Outsourcing von Vergabestellenleistungen. Ist dies eine Nebenleistung zum Leistungsbild der Projektsteuerung, wenn doch gar keine nennenswerten anderen Leistungen übernommen werden, wenn es also gerade an der gesamthaften Projektverantwortung fehlt? Der Bundesgerichtshof hat schon in den 1970er Jahren unter Geltung des Rechtsberatungsgesetzes signalisiert, wie es um die Zulässigkeit der Projektsteuerung stehen dürfte, wenn dem Projektsteuerer nur Teilleistungen übertragen werden, sodass nicht mehr die Erstellung des Bauwerks im Vordergrund stehe (BGH NJW 1976, 1635). Unter Berücksichtigung der weiteren Rechtsprechungsentwicklung kann festgestellt werden: Sind die Vorbereitung und Abwicklung des Vergabeverfahrens nach den Abreden zwischen den Parteien gar keine Neben-, sondern Haupttätigkeiten, dann ist § 5 RDG schlicht nicht anwendbar. Dieses Ergebnis steht nicht in Widerspruch zu dem Diktum, dass der Charakter einer Haupt- oder Nebentätigkeit nicht „herbeigeschrieben“ werden kann, sondern objektiv zu beurteilen ist. Denn der Sinn und Zweck dieses Diktums ist es, zu verhindern, dass dem Entscheider ein X für ein U vorgemacht wird. Das Ergebnis nimmt schlicht die Gegebenheiten des Einzelfalls in den Blick, in dem nun mal keine Projektsteuerung beauftragt wird, sondern – die Vorbereitung und Abwicklung eines Vergabeverfahrens, die vor allem die Erbringung von Rechtsdienstleistungen beinhaltet.
bb. Gruppe 2: das externe Sekretariat
Die zweite Gruppe ist die der Projektmanager, wobei die Bezeichnung als externes Sekretariat es wohl etwas besser trifft. Während ein sachlicher Zusammenhang der Sekretariatsarbeiten mit den Rechtsdienstleistungen, die in einem extern abgewickelten Vergabeverfahren anfallen, platt auf der Hand liegt, fragt sich, worin denn nun eigentlich die Haupttätigkeit bestehen soll. Tatsächlich ist die Haupttätigkeit im Vergabeverfahren die Erbringung der o.g. Rechtsdienstleistungen und keine andersgeartete Sekretariatsarbeit. Diese nimmt im Gegenteil nur einen Bruchteil der Zeit ein, die für die Erbringung der unweigerlich in jedem Vergabeverfahren zu erbringenden Rechtsdienstleistungen aufgewendet wird. Es fehlt m.a.W. an einer Haupttätigkeit des externen Sekretariats, zu dem die vielfältigen Rechtsdienstleistungen Nebentätigkeit sein könnten. Dies wird auch deutlich, wenn mit dem BGH auf die Identität des Rechtskenntnisse abgestellt wird (BGH GRUR 2016, 820 Rn. 29 – Schadensregulierung durch Versicherungsmakler). Es werden nun mal gerade nicht dieselben Rechtskenntnisse für die Sekretariatsarbeiten als angebliche Haupttätigkeit benötigt wie für die vielfältigen Prüfungs- und Würdigungsleistungen, die die Begleitung jedes Vergabeverfahrens kennzeichnen.
Auch wenn man vor diesem einfachen Zusammenhang die Augen verschließt und etwa mit dem OLG Düsseldorf in der Versandvorbereitung von Schreiben oder im Dokumentieren stattgehabter Kommunikation die sekretariatsmäßige Haupttätigkeit des Dienstleisters erblickt, wird man mit dem OLG Düsseldorf – auch um den Widerspruch zu ständigen Rechtsprechung des BGH nicht allzu augenfällig werden zu lassen – nur für sehr, sehr einfach gelagerte, von vornherein eng umgrenzte Vergabeverfahren eine aufgrund ihres Umfangs und Inhalts gestattete Nebenleistung annehmen können. Das OLG Düsseldorf spricht von 100%-Preisvergaben standardisierter Dienstleistungen, die komplett musterbasiert und anhand metrischer Kriterien erfolgen, sodass auch nur bereits vorhandene, vom Auftraggeber bereitzustellende und v.a. auch nicht zu prüfende Muster ausgefüllt werden. Bei diesen Vergaben erscheint freilich ein etwas größerer Leistungsanteil als sekretariatsmäßige Arbeit.
3. Schein-Auswege
Es gibt diverse Auswege, die in der Praxis zum Schein gewählt werden. Eine Möglichkeit ist es, die Rechtsdienstleistungen „auszuklammern“, gerne mit dem erläuternden Zusatz, bei den hiesigen Leistungen handle es sich nicht um Rechtsdienstleistungen oder nicht um Anwälten vorbehaltene Rechtsdienstleistungen.
Dieses Unterfangen ist aufgrund der Weite des Rechtsdienstleistungsbegriffs von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Einzelhandlungen im Vergabeverfahren sind nun mal beinahe ausnahmslos Rechtsdienstleistungen. Abgesehen davon interessiert nicht die Bezeichnung, die der Auftraggeber wählt („Namen sind Schall und Rauch“), sondern der sachliche Gehalt der Tätigkeit. Jener wird unabhängig vom Auftraggeber beurteilt, und zwar von unabhängigen Gerichten. Anders formuliert: Wenn es regnet, regnet es, auch wenn der König sagt, es schneit.
Ein anderer Schein-Ausweg besteht darin, dem Auftraggeber die Letztentscheidung vorzubehalten und nur Prüfungs- oder Vorbereitungstätigkeiten auf den Dienstleister zu übertragen. Auch diese Vorgehensweise führt nicht zum anscheinend erhofften Ziel, nicht-anwaltliche Dienstleister beauftragen zu dürfen. Auch Anwälte treffen keine Letztentscheidungen, diese sind vielmehr dem Auftraggeber vorbehalten, und Prüfung und Vorbereitung, solange sie selbstständig entgeltlich erfolgt, sind nun mal gerade Kennzeichen einer Rechtsdienstleistung, wenn sie in der Subsumtion von Sachverhalten unter Rechtsnormen besteht, wie es in der Vergabevorbereitung und -abwicklung nun mal typischerweise der Fall ist.
Ein weiterer Schein-Ausweg ist die Überbetonung fachlicher und wirtschaftlicher Fragen, die angeblich ebenfalls zu klären seien, und die die Rechtsdienstleistungen als von geringer Bedeutung erscheinen ließen. Auch dieser Ausweg führt in die Irre und ist somit ein nur vermeintlicher. § 5 RDG erlaubt nur Nebenleistungen, die nicht nur ihrem Umfang, sondern auch ihrer Komplexität nach gleichsam miterledigt werden können. Dies wird u.U. noch für durchstandardisierte, also vollständig musterbasierte 100%-Preisvergaben zu bejahen sein, nicht aber für Vergaben, die bedeutende fachliche und auch wirtschaftliche Fragen aufwerfen. Ganz im Gegenteil. Hier stellen sich typischerweise auch eher anspruchsvolle Rechtsfragen.
Ein letzter Schein-Ausweg ist es, dem nicht-anwaltlichen Dienstleister aufzugeben, doch einen Anwalt hinzuziehen. Dies hat die Rechtsprechung bereits verworfen, da der nicht-anwaltliche Dienstleister ja zur Leistung gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet bleibt (BGH, Urt. v. 29.07.2009 – I ZR 166/06, juris, Rn. 22 ff.).
4. Einziger Ausweg de lege lata: Rechtsanwalt
Es bleibt nur der Anwalt, der als allein hierzu befugter Dienstleister sämtliche Aufgaben der Vorbereitung und Abwicklung übernehmen darf.
Die vergaberechtlich tätigen Anwälte müssen sich allerdings fragen, warum einige Auftraggeber beträchtliche Anstrengungen unternehmen und vor allem auch beträchtliche, ans Seltsame grenzende Risiken für sich und ihre Mitarbeiter eingehen, um bloß nicht vergaberechtlich tätige Anwälte zu beauftragen.
Ein Problem ist sicherlich der Preis. Wenn auch die Stundensätze im Vergaberecht bekanntlich eher niedrig sind, zumindest verglichen mit denen anderer im Wirtschaftsrecht tätiger Kollegen, so sind sie teilweise doch immer noch höher als die vieler anderer Berater. Ich betone: teilweise. Gut gemachte Ausschreibungen der letzten Zeit haben auch hier erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert. Außerdem zwingt niemand den Auftraggeber, die Leistungen nach Aufwand zu bezahlen. Er kann Voll- oder Teil-Pauschalen abfragen etc., freilich muss er sich dann Rückfragen und kritische Blicke gefallen lassen von Personen, die oft auch die rechtlichen Grenzen der Pauschalpreisbildung gut einschätzen können.
Ein anderes Problem ist die Kapazität. Bei Anwälten, so die Erfahrung vieler Mandanten, geht immer noch einer rein, auch wenn lange keiner mehr reingeht. Niemand jedoch zwingt den Auftraggeber, auf Kapazitätsvorgaben, Vertragsstrafen etc. zu verzichten.
5. Auswege de lege ferenda
Künftig wäre es zu begrüßen, wenn Vergabebegleiter als Rechtsdienstleister anerkannt werden würden und zugleich das Berufsbild gesetzlich geregelt würde, sodass die Tätigkeit aufgrund eines anderen Gesetzes gestattet wäre (vgl. den interessanten Vorschlag bei Lieb a.a.O., S. 303). Das Vorbild könnten Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO sein. In diesem Fall würde allerdings auch das Erfordernis einer Versicherung und vor allem auch einer Sachkundeprüfung bestehen. Wer die Komplexität des Vergaberechts als höher einschätzt, wird eher in Richtung Steuerberater denken müssen. Zwischen Sachkunde- und Steuerberaterprüfung sind viele Spielarten denkbar.
Dr. Christoph Kins
Der Autor Dr. Christoph Kins ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht. Er ist Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei abante in Leipzig, die sich auf Vergabe- und Vertragsrecht vor allem für öffentliche Auftraggeber spezialisiert hat. Herr Kins berät öffentliche Auftraggeber, Bieter, Bewerber und Zuwendungsempfänger. Er führt Seminare und Schulungen durch und veröffentlich regelmäßig Fachbeiträge zum Thema Vergaberecht.



 (55 Bewertungen, durchschn.: 3,80aus 5)
(55 Bewertungen, durchschn.: 3,80aus 5)








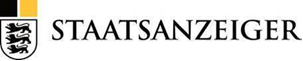
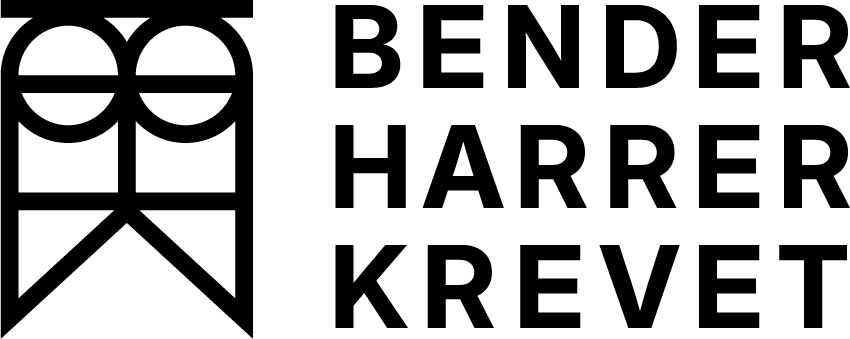
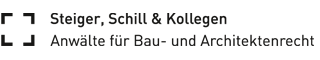
Schreibe einen Kommentar