 Der Zugang von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittländern, die nicht Teil des GPA oder eines ähnlichen Abkommens sind, war auf europäischer Ebene bereits seit einiger Zeit ein zunehmend konkretes Thema, hat die deutschen Gerichte jedoch bisher lediglich vereinzelt beschäftigt. Während die allermeisten Auftraggeber keine Berührungspunkte mit Bietern aus Drittstaaten haben, ist dies in bestimmten Branchen, z.B. im Verteidigungs- oder Fahrzeugbereich, durchaus von Bedeutung. Die Relevanz des Themas zeigt nicht nur der Referentenentwurf zum Vergabetransformationspaket, sondern auch die Entscheidung des EuGH in Sachen „Kolin Inşaat Turzim sanayi ve Ticaret“ („Kolin“), die massive Konsequenzen für die Beteiligung von Bietern aus nicht vertragsgebundenen Drittstaaten hat.
Der Zugang von Wirtschaftsteilnehmern aus Drittländern, die nicht Teil des GPA oder eines ähnlichen Abkommens sind, war auf europäischer Ebene bereits seit einiger Zeit ein zunehmend konkretes Thema, hat die deutschen Gerichte jedoch bisher lediglich vereinzelt beschäftigt. Während die allermeisten Auftraggeber keine Berührungspunkte mit Bietern aus Drittstaaten haben, ist dies in bestimmten Branchen, z.B. im Verteidigungs- oder Fahrzeugbereich, durchaus von Bedeutung. Die Relevanz des Themas zeigt nicht nur der Referentenentwurf zum Vergabetransformationspaket, sondern auch die Entscheidung des EuGH in Sachen „Kolin Inşaat Turzim sanayi ve Ticaret“ („Kolin“), die massive Konsequenzen für die Beteiligung von Bietern aus nicht vertragsgebundenen Drittstaaten hat.
Leitsatz
Wirtschaftsteilnehmer aus Drittländern, die keine internationale Übereinkunft mit der Union geschlossen haben, die in wechselseitiger und gleicher Weise den Zugang zu den öffentlichen Aufträgen gewährleistet, haben kein Recht auf eine ‚nicht ungünstigere Behandlung‘. Auf die Teilnahme eines solchen Wirtschaftsteilnehmers an einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrages ist die Richtlinie 2014/25 nicht anwendbar.
Sachverhalt
Am 07.09.2020 leitete eine kroatische öffentliche Auftraggeberin ein offenes Verfahren zur Erneuerung von Eisenbahninfrastruktur in Kroatien ein. Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit mussten die Bieter eine Aufstellung vergleichbarer Arbeiten der letzten zehn Jahre einreichen und detailliert beschreiben. Am 25.02.2022 wurde der Zuschlag schließlich auf das Angebot der Bietergemeinschaft Strabag AG erteilt. Auf Beschwerde des in der Türkei niedergelassenen Bieterunternehmens Kolin Inşaat Turzim sanayi ve Ticaret (Kolin) wurde die Vergabeentscheidung am 10.03.2022 durch die staatliche Kontrollmission für die öffentliche Auftragsvergabe aufgehoben, da die Strabag AG ihre Leistungsfähigkeit nicht wie in den Ausschreibungsbedingungen gefordert nachgewiesen hatte. Auf Aufforderung der Auftraggeberin legte die Strabag AG eine überarbeitete Aufstellung der Arbeiten vor und ergänzte die Aufstellung bei der Gelegenheit um eine weitere Referenz. Am 28.04.2022 erteilte die Auftraggeberin wiederum den Zuschlag an die Strabag AG. Dagegen macht die Antragstellerin Kolin geltend, dass die Auftraggeberin nicht zur Vorlage zusätzlicher Nachweise hätte auffordern dürfen. Da die Beschwerde bei der Kontrollmission erfolglos blieb, erhob die Antragstellerin Klage beim Verwaltungsgericht. Dieses hat Zweifel, ob Strabag zusätzliche Referenzen angeben durfte, obwohl diese im ursprünglichen Angebot nicht enthalten waren und legt die Frage daher dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.
Die Entscheidung
Der EuGH äußert sich im Ergebnis nicht zur gestellten Frage, sondern lehnt das Vorabentscheidungsgesuch bereits als unzulässig ab:
Da das antragstellende Unternehmen Kolin als Unternehmen aus einem Drittstaat keinen Anspruch auf Gleichbehandlung nach der maßgeblichen RL 2014/25 habe, sei die Klärung der Vorlagefrage zur Zulässigkeit der Nachforderung der Referenz schon nicht erforderlich, um die Entscheidung in der Sache zu treffen.
Die Union sei durch internationale Übereinkünfte wie beispielsweise das GPA gebunden, Wirtschaftsteilnehmern aus Signatarstaaten dieser Länder den Zugang zu öffentlichen Aufträgen in gleicher Weise zu ermöglichen. Diese internationalen Verpflichtungen seien auch in Art. 43 der Richtlinie 2014/25/EU und dem Erwägungsgrund 27 der Richtlinie zu finden. Dies habe zur Folge, dass Wirtschaftsteilnehmern der betreffenden Signatarstaaten keine ungünstigeren Bedingungen auferlegt werden dürften als jenen aus der Europäischen Union (Rdnr. 42).
Für Wirtschaftsteilnehmer aus anderen Drittstaaten, die kein solches Übereinkommen unterzeichnet haben, darunter auch die Türkei, gelte dies jedoch gerade nicht. Diesbezüglich sei die Richtlinie 2014/25/EU dahingehend auszulegen, dass der Zugang von Wirtschaftsteilnehmern aus den betreffenden Drittländern zu Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge nicht gewährleistet ist und diese Wirtschaftsteilnehmer davon ausgeschlossen werden können (Rdnr. 47). Sofern sie zur Teilnahme an einem solchen Verfahren zugelassen werden, können sie sich auch nicht auf die Richtlinie und insbesondere nicht auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen, um eine Vergabeentscheidung anzufechten.
Ferner führt der EuGH aus, dass der Zugang zu Vergabeverfahren für Wirtschaftsteilnehmer aus Drittländern, mit denen kein Übereinkommen besteht, die gemeinsame Handelspolitik im Sinne des Art. 207 AEUV betrifft, für die nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e AEUV die ausschließliche Zuständigkeit bei der Union liegt (Rdnr. 56). Aufgrund dieser ausschließlichen Zuständigkeit und mangels gegenteiliger Ermächtigung sei es den Mitgliedstaaten nicht gestattet, in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden (Rdnr. 61 f.)
Unter Berücksichtigung dessen stehe es dem Auftraggeber nach Ansicht des EuGH frei, ob er jene Wirtschaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren zulässt und ob er in den Auftragsunterlagen Behandlungsmodalitäten aufführt, die den objektiven Unterschied der Rechtsstellung zwischen Wirtschaftsteilnehmern aus der Union und ihren verbundenen Drittländern oder jenen aus Drittländern ohne Übereinkunft aufzeigen. Rechtsbehelfe jener Wirtschaftsteilnehmer seien daher lediglich anhand des nationalen Rechts zu prüfen.
Rechtliche Würdigung
Der EuGH folgt mit seiner Entscheidung der aktuellen Entwicklung, den Zugang zu Vergabeverfahren für Wirtschaftsteilnehmer aus Drittstaaten zunehmend zu beschränken.
Die EU-Kommission hat sich diesbezüglich bereits 2019 in einer Mitteilung (C(2019) 5494) sowie 2020 in Form eines „White Paper“ positioniert, in dem erörtert wurde, wie der Wettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen vor wettbewerbsverzerrenden drittstaatlichen Subventionen zu schützen sei. Die dort aufgezeigten vorhandenen und möglichen weiteren Ansätze wurden zwischenzeitlich weiterentwickelt.
So trat am 29.08.2022 die Verordnung IPI-Verordnung 2022/1031 mit dem Ziel in Kraft, die Gegenseitigkeit beim Zugang zum internationalen Markt für öffentliche Aufträge zu fördern. Zu diesem Zweck legt die Verordnung Verfahren fest, die es der Europäischen Kommission ermöglichen, mutmaßliche Maßnahmen oder Praktiken, die den Zugang von Unternehmen, Waren und Dienstleistungen aus der EU zu Nicht-EU-Beschaffungsmärkten negativ beeinflussen, zu untersuchen, Konsultationen mit den betreffenden Nicht-EU-Ländern durchzuführen und schließlich als letztes Mittel IPI-Maßnahmen zu verhängen, um den Zugang zu öffentlichen Beschaffungsverfahren in der EU für Unternehmen, Waren und Dienstleistungen aus den betreffenden Nicht-EU-Ländern zu beschränken.
Ergänzt wird die Regelung durch die Verordnung 2022/2560, die Foreign Subsidies Regulation. Diese ermöglicht es der Kommission, drittstaatlichen Subventionen auf eine mögliche Wettbewerbsverzerrung zu untersuchen und falls erforderlich, Maßnahmen aufzuerlegen, die den wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen entgegenwirken.
Die IPI- und FSR-Verordnungen verdeutlichen, dass nach Auffassung der Kommission die Vergaberichtlinien den Ausschluss von Bietern aus Drittländern nicht regeln, denn andernfalls wären die Verordnungen redundant. Dies scheint auch die Position des EuGH zu sein, auch wenn vor dem Hintergrund der Betonung der ausschließlichen Kompetenz der EU unklar ist, wer und in welcher Form Zugangsmöglichkeiten für Bieter aus Drittstaaten eröffnen kann. Die Mitgliedstaaten wären es nach der vorliegenden Entscheidung jedenfalls nicht, die Entscheidung soll – so der EuGH – der jeweilige Auftraggeber treffen (Rz. 63 und 64).
Ob eine solche Gestaltung auch in Form einer generellen Zulassung erfolgen dürfe, wird jedoch vom folgenden Absatz wieder in Frage gestellt:
„Jedenfalls dürfen nationale Behörden die nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/25 nicht dahin auslegen, dass sie auch auf von einem Auftraggeber zur Teilnahme an einem Verfahren für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags in dem betreffenden Mitgliedstaat möglicherweise zugelassene Wirtschaftsteilnehmer aus Drittländern anwendbar sind, die mit der Union keine derartige Übereinkunft geschlossen haben, da sonst der ausschließliche Charakter der Zuständigkeit der Union in diesem Bereich missachtet würde.“
Die individuelle Entscheidung eines Aufraggebers für eine uneingeschränkte Zulassung wäre dann also nicht zulässig.
Dies wird umso spannender in Zusammenschau mit der folgenden Randziffer, die den Ball ins nationale Recht spielt:
„Zwar ist denkbar, dass die Modalitäten der Behandlung dieser Wirtschaftsteilnehmer bestimmten Anforderungen, wie denen der Transparenz oder der Verhältnismäßigkeit, entsprechen müssen, doch kann ein Rechtsbehelf eines dieser Wirtschaftsteilnehmer, mit dem gerügt wird, dass der Auftraggeber solche Anforderungen nicht beachtet habe, nur anhand des nationalen Rechts und nicht anhand des Unionsrechts geprüft werden.“
Angesichts der postulierten Zuständigkeit des EU Gesetzgebers in der grundsätzlichen Frage der Zulassung zum Vergabeverfahren kann dies also nur nationale Regeln betreffen, die gerade nicht in Umsetzung der Vergaberichtlinien ergehen? Was dies in der konkreten Ausgestaltung bedeutet, bleibt offen.
Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf die Rechtslage in Deutschland?
Eine ausdrückliche Regelung zur Rolle der Bieter aus Drittstaaten findet sich in Bezug auf klassische Auftraggeber bislang im deutschen nationalen Vergaberecht nicht. Unter Berufung auf den sog. „Drei-Minister-Erlass“ von 1960 hatten Unternehmen aus Drittstaaten die Möglichkeit, gleichberechtigt auf dem deutschen Beschaffungsmarkt zu agieren, losgelöst davon, ob diese Öffnung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stand. Ihnen standen alle gesetzlichen Ansprüche des § 97 Abs. 7 GWB a.F. in vollem Umfang zu.
Einschränkungen betrafen lediglich den Sektorenbereich, in dem Auftraggeber Angebote zurückweisen konnten, deren Warenanteil zu mehr als 50% des Gesamtwertes aus Drittstaaten stammte, mit denen keine Vereinbarung über den gegenseitigen Marktzugang bestand.
Diese Sonderregelung ist in § 55 SektVO in Umsetzung des Art. 85 Abs. 2 der Richtlinie 2014/25/EU kodifiziert und schafft – so das OLG Brandenburg (Beschl. v. 02.06.2020 – 19 Verg 1/20) – eine „unionsrechtliche Erlaubnis zur Diskriminierung von Warenangeboten aus den betreffenden Drittländern“. In seiner Entscheidung führt das Gericht ferner aus, dass die Zurückweisungsbefugnis nach § 55 Abs. 1 SektVO in das Ermessen des Auftraggebers falle.
Dieser marktoffene Grundansatz wurde auch in jüngeren Entscheidungen durch die Rechtsprechung bestätigt:
Auch Bieter aus Drittstaaten, die nicht Teil des GPA oder vergleichbaren Übereinkommen sind, können sich danach auf den Grundsatz der Gleichbehandlung gem. § 97 Abs. 1 S. 1 GWB berufen, wenn ihnen der Zugang zum Verfahren gewährt wurde (so OLG Düsseldorf, Beschl. v. 31.05.2017 – Verg 36/16). Diese Linie wurde auch durch eine spätere Entscheidung des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 01.12.2021 – VII-Verg 54/20) aufrechterhalten, indem der Senat ausdrücklich klarstellt, dass das Diskriminierungsverbot des Art. 25 RL 2014/24/EU bezüglich Bieter aus GPA-Staaten und Freihandelszonen keinesfalls im Umkehrschluss einen Erlaubnistatbestand für Ungleichbehandlungen von Bietern aus anderen Staaten darstelle. Dafür spreche auch Art. 85 der Richtlinie 2014/25/EU, der lediglich eine Zurückweisungsmöglichkeit für Angebote, welche zu mehr als 50 % Waren aus Drittstaaten enthalten, normiere. Die Vorschrift impliziere, dass eine Ungleichbehandlung auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen müsse.
Eine unterschiedliche Behandlung von Bietern aus Drittstaaten im Vergleich zu jenen aus der EU oder der Freihandelszone barg bisher das Risiko eines (erfolgreichen) Nachprüfungsverfahrens.
Diese grundsätzliche Position wird wohl nach der Entscheidung des EuGH nicht aufrecht erhalten bleiben können.
Angesichts der Entscheidung des EuGH spricht viel dafür, dass ein Nachprüfungsantrag bereits auf Zulässigkeitsebene scheitern würde. Das OLG Düsseldorf hatte 2017 die Frage, ob sich das betreffende Unternehmen auf § 97 Abs. 6 GWB berufen kann zunächst im Rahmen der Antragsbefugnis und damit auf Zulässigkeitsebene diskutiert (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 31.05.2017 – Verg 36/16). Im darauffolgenden Beschluss wird ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus § 97 Abs. 2 GWB zwar im Rahmen der Begründetheit diskutiert, dies ist allerdings dem Umstand geschuldet, dass die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung zu einem Fortsetzungsfeststellungsantrag übergegangen war und mithin die Feststellung eines Verstoßes gegen den vergaberechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz unstatthaft ist (Beschl. v. 01.12.2021 – VII-Verg 54/20).
Der EuGH legt diesbezüglich lediglich fest, dass „das Unionsrecht es zwar nicht verbietet, diese Wirtschaftsteilnehmer mangels von der Union erlassener Ausschlussmaßnahmen zur Teilnahme an einem unter die Richtlinie 2014/25 fallenden Verfahren für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags zuzulassen, dass es diese Wirtschaftsteilnehmer jedoch daran hindert, sich im Rahmen ihrer Teilnahme an einem solchen Verfahren auf diese Richtlinie zu berufen und somit eine Gleichbehandlung ihres Angebots mit den Angeboten zu fordern, die Bieter aus den Mitgliedstaaten und Bieter aus Drittländern im Sinne von Art. 43 dieser Richtlinie abgegeben haben“ (Rdnr. 45). Es erscheint naheliegend, dass der Rechtsbehelf bereits für unzulässig erklärt werden muss, die Frage wird jedoch nicht eindeutig geklärt.
Wie ist die vorgeschlagene Neuregelung des Referentenentwurfes zum Umgang mit Bietern aus Drittstaaten im Lichte der Entscheidung zu beurteilen?
Laut der Begründung im Referentenentwurf des Vergabetransformationspaketes, der am 18.10.2024 veröffentlicht wurde, soll sich die Rechtslage in Deutschland der europäischen Auffassung anpassen.
Der Entwurf sieht unter anderem die Einfügung eines § 112a GWB vor, der es Auftraggebern ermöglicht, den Zugang zu Vergabeverfahren mit Blick auf die Ansässigkeit der Bewerber oder Bieter in einem bestimmten Drittstaat zu beschränken und normiert insoweit eine gesetzlich gestattete Ungleichbehandlung im Sinne von § 97 Abs. 2 GWB.
In der Begründung führt der Entwurf ausdrücklich aus, dass sich entgegen der Auffassung des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 01.12.2021 – VII-Verg 54/20) eine unionsrechtliche Unzulässigkeit der Ungleichbehandlung nicht aus einem Rückschluss aus Art. 85 der Richtlinie 2014/25/EU ergebe, da diese Vorschrift lediglich an die Herkunft der Waren und nicht an den Sitz der Bieterunternehmen anknüpfe (S.69).
Im Grundansatz nähert der Referentenentwurf die Rechtslage in Deutschland dem Verständnis der Kommission und wohl auch des EuGH an. Ein dogmatischer Unterschied besteht allerdings darin, dass die Ungleichbehandlung nach deutscher Auffassung auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen muss. Inhaltlich beschränkt der Vorschlag des neuen § 112 a GWB das Recht zur Beschränkung der Teilnahme lediglich für Aufträge in den Bereichen kritische Infrastruktur sowie verteidigungs- und sicherheitsrelevanter Aufträge (§ 112a Abs. 3). Damit weicht er von der Rechtslage nach dem EuGH ab, nach der Auftraggeber in jedem Fall Wirtschaftsteilnehmer aus Drittstaaten vom Verfahren ausschließen dürfen. Die sich aus der vorgeschlagenen Regelung des § 112 a GWB im Rückschluss ergebende Öffnung des Beschaffungsmarktes für Bieter in Bezug auf alle anderen Aufträge, wäre nach der klaren Positionierung des EuGH wohl nicht mit der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der EU im Einklang.
Praxistipp
Losgelöst von der Umsetzung des Vergabetransformationspaketes bedeutet die Entscheidung eine Verschlechterung der Zugangschancen von Unternehmen aus nicht vertragsgebundenen Drittstaaten zu europäischen und auch des deutschen Beschaffungsmarktes. Dies gilt wohl losgelöst davon, ob ein Auftraggeber sich konkret zum Ausschluss / zu Beteiligungsmöglichkeiten solcher Unternehmen in der Ausschreibung geäußert hat. Bedauerlich ist die verbleibende Unsicherheit hinsichtlich der nach dem EuGH verbleibenden nationalen Gestaltungsspielräume des einzelnen Auftraggebers, die wohl erst durch entsprechende Hinweise der Kommission oder durch nationale Entscheidungen und ggf. weitere Vorlagen zum EuGH vollständig ausgeräumt werden können.
Kontribution
Der Beitrag wurde gemeinsam mit Frau Chiara Groppe, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kanzlei FPS Fritze Wicke, Seelig, Frankfurt am Main, verfasst.
Dr. Annette Rosenkötter
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Vergaberecht sowie Verwaltungsrecht Frau Dr. Rosenkötter ist Partnerin in der Sozietät FPS Fritze Wicke Seelig in Frankfurt a.M.. Sie berät im Vergaberecht als auch im europäischen Beihilfenrecht, dort insbesondere im Gesundheits- und im ÖPNV-Bereich. Frau Dr. Rosenkötter hält regelmäßig Vorträge und Schulungen zum Vergaberecht und hat zahlreiche vergaberechtliche Fachbeiträge veröffentlicht.


 (4 Bewertungen, durchschn.: 4,00aus 5)
(4 Bewertungen, durchschn.: 4,00aus 5)









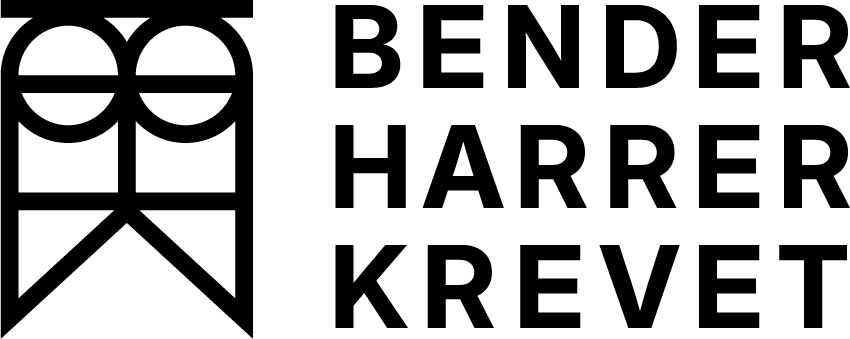

Schreibe einen Kommentar