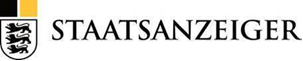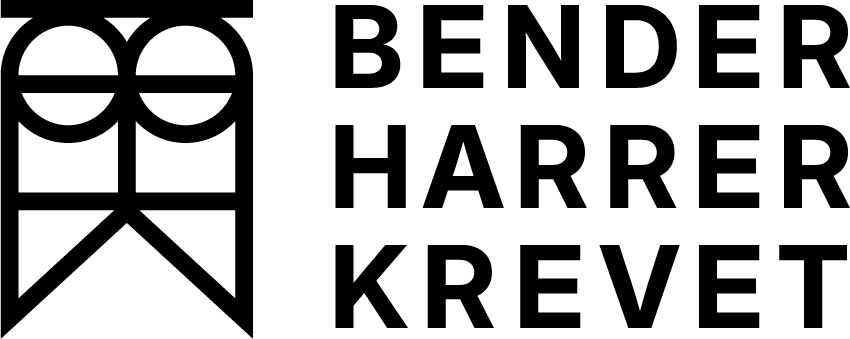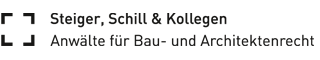-

In der Beschaffungspraxis können Inhouse-Geschäfte in verschiedenen Varianten vorkommen. Die Regeln dazu in § 108 GWB sind umfangreich. Die Rechtsprechung hat in den letzten Jahren Grenzen für kreative Inhouse-Geschäfte aufgezeigt. Der obergerichtlich entschiedene Fall einer Schwester-Schwester-Vergabe zeigt das besonders deutlich.
-

Mit den in § 108 GWB geregelten Vergabeausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit sollte die Rechtsunsicherheit bei Inhouse-Geschäften und interkommunaler Zusammenarbeit beseitigt werden. Erreicht wurde das gesetzgeberische Ziel noch nicht. Vor allem Beschaffungen bei gemeinsamer Kontrolle mehrerer öffentlicher Auftraggeber sind fehleranfällig, wie ein Richterspruch des EuGH beweist.
-

Erst im Februar diesen Jahres hat der EuGH einen ausschreibungsfreien Auftragnehmerwechsel bei Insolvenz erleichtert (vgl. Vergabeblog.de vom 28/02/2022, Nr. 48994). Nun legen die Luxemburger Richter für Inhouse-Geschäfte und Unternehmensumstrukturierungen einen strengeren Maßstab an. Der EuGH entschied, dass der Rechtsnachfolger die Leistungen eines inhouse-beauftragten Auftragnehmers nicht nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchst. b) GWB fortführen darf, wenn die Inhouse-Voraussetzungen zum Rechtsnachfolger nicht vorliegen.
-

Bietergemeinschaften (BiGe) werden in der Beschaffungspraxis häufig gebildet. Unternehmen versuchen dadurch ihre Wettbewerbschancen zu verbessern oder erst zu ermöglichen. Auftraggeber hingegen sehen BiGe mitunter skeptisch. Insbesondere im Hinblick auf die Leistungserbringung werden häufig Bedenken angemeldet. Das Vergaberecht will dem vorbeugen. Öffentliche Auftraggeber können daher vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben von einem BiGe-Mitglied ausgeführt werden müssen. Darf eine Vergabestelle auch verlangen, dass die Leistungen mehrheitlich vom bevollmächtigten Mitglied einer BiGe direkt erfüllt werden? Der EuGH verneint die Frage.
-

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung von Auftragnehmern führen häufig zu organisatorischen Umstrukturierungen. Wird ein Auftragnehmer durch einen anderen Auftragnehmer während der Laufzeit eines öffentlichen Auftrages ersetzt, stellt dies nach § 132 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 GWB eine wesentliche Änderung dar. Ein neues Vergabeverfahren ist dann notwendig. Gegebenenfalls steht dem öffentlichen Auftraggeber nach § 133 Abs. 1 Nr. 1 GWB sogar ein Kündigungsrecht zur Seite. Keine erneute Ausschreibung ist ausnahmsweise nötig, wenn der Auftragnehmerwechsel im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung erfolgt. Dazu zählt auch die Insolvenz. Wird dabei nur ein Vertrag des insolventen Auftragnehmers und kein Geschäftsbereich oder keine Betriebssparte übernommen, stellt sich die Frage nach einem zulässigen Auftragnehmerwechsel.
-

Beruf und Beschäftigung sind wesentliche Eckpfeiler bei der Integration von Menschen mit Behinderung und benachteiligten Personen. Besonders wichtig sind dabei Behindertenwerkstätten und Unternehmen, deren Hauptzweck in der sozialen und beruflichen Integration dieser Personen liegt (Sozialunternehmen). Unter normalen Wettbewerbsbedingungen
-

Das EU-Vergaberecht unterscheidet drei Eignungskriterien: (1.) die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, (2.) die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit und (3.) die technische und berufliche Leistungsfähigkeit. Wenn von Unternehmen bestimmte Eignungsmerkmale gefordert werden sollen, dann müssen diese vom öffentlichen Auftraggeber den Eignungskriterien zwingend zugeordnet werden.
-

Unternehmen, die öffentliche Aufträge ausführen, müssen alle für sie geltenden rechtlichen Vorschriften beachten. Während § 128 Abs. 1 GWB eine generelle Aussage zu den bei der Auftragsausführung einzuhaltenden Rechtsvorschriften trifft, kann der öffentliche Auftraggeber nach § 128 Abs. 2 GWB individuelle Ausführungsbedingungen vorgeben, die ihm sinnvoll erscheinen. Nach Ansicht des EuGH kann es aber problematisch sein, von Unternehmen Nachweise im Vergabeverfahren zu fordern, solche Ausführungsbedingungen auch einzuhalten.
-

Ein langjähriger Dauerbrenner in der öffentlichen Beschaffungsdiskussion ist das Verhältnis vom ausschreibungspflichtigen Bauauftrag einerseits und vergabefreien Mietvertrag andererseits. Dabei geraten häufig die mieterseitigen Wünsche und Anforderungen in einen vergaberechtlichen Abgrenzungskonflikt zu den Wesensmerkmalen eines öffentlichen Bauauftrages. Insbesondere dann, wenn das Mietobjekt noch nicht gebaut wurde, stellt sich die Frage, in welchem Umfang der künftige Mieter Einfluss auf die Gestaltung des noch zu errichtenden Gebäudes nehmen darf, ohne dass die rote Linie des Vergaberechts überschritten wird.
-

Die Auftraggebereigenschaft ist eine grundlegende Voraussetzung, europäisches Vergaberecht anwenden zu müssen. Sie wirft deshalb häufig Fragen auf. Dies gilt vor allem für öffentliche Einrichtungen nach § 99 Nr. 2 GWB und ihre unbestimmten Tatbestandsmerkmale. Steht eine Organisation aus einem eher weniger mit dem Öffentlichen Auftragswesen verbundenen Sektor im Mittelpunkt europäischer Rechtsprechung, wie der italienische Fußballverband, so stellt sich auch für deutsche Sportverbände, wie dem Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) oder Deutscher Olympischer Sportbund e.V. (DOSB), die generelle Frage nach der EU-Vergabepflicht.
-
Wir haben fachliche und persönliche Fragen an die Autoren des Vergabeblogs gerichtet. Gefragt wurden sämtliche Autoren, die auf unserer Autorenseite im August 2018 mit Profil angezeigt werden (siehe hier). Heute in der Serie Steckbriefe 2018: Herr RA Holger Schröder.
Netzwerk-Login