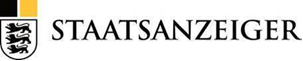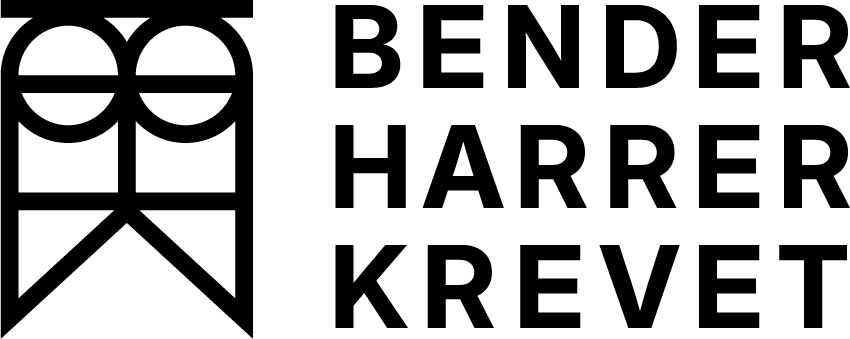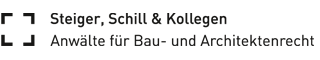-
Alles fließt – besser lassen sich die aktuellen Entwicklungen des Vergaberechts nicht beschreiben. Und was mit Blick auf die neuen EU-Richtlinien für das große Ganze gilt, trifft natürlich auch für den kleineren Bereich der Zuschlagskriterien zu. Damit unseren Lesern mit dieser Beitragsreihe auch weiterhin ein praxisorientierter Leitfaden zur Seite steht, hat unser Autor RA Dr Christian-David Wagner die Serie überarbeitet und um die aktuelle Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex ergänzt.
-
In Teil 4 der Beitragsreihe wurde dargestellt, dass der öffentliche Auftraggeber den Bietern alle Zuschlags- und Unterkriterien, deren Verwendung er vorsieht, einschließlich ihrer Gewichtung, bekannt machen muss. Der öffentliche Auftraggeber darf keine Unterkriterien oder Gewichtungsregeln anwenden, die er den am Auftrag interessierten Unternehmen nicht vorher zur Kenntnis gebracht hat (vgl. nur EuGH, Urteil vom 24.01.2008 – Rs. C-331/04; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30.07.2009 – Verg 10/09; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.06.2013 – VII-Verg 8/13; so auch OLG Celle, Beschluss vom 07.11.2013 – 13 Verg 8/13; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.01.2014 – 15 Verg 10/13). Aufgrund der Komplexität von Beschaffungsvorhaben oder haushaltrechtlicher Vorgaben kommt es in der Vergabepraxis jedoch nicht selten vor, dass die bekannt gemachten Wertungskriterien abgeändert werden müssen. Die Frage, inwieweit eine nachträgliche Änderung der Zuschlags- und Unterkriterien und ihrer Gewichtung zulässig ist, soll im Folgenden dargestellt werden.
-
Die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die festgelegten Zuschlagskriterien und Gewichtungsregeln den Bietern bekannt zu geben, ist von Anbeginn Gegenstand der nationalen und europäischen Rechtsprechung. Wie weit danach die Bekanntmachungspflicht der Auftraggeber reicht, soll nachfolgend skizziert werden.
-
Über die Auswahl der Zuschlags- und Unterkriterien sowie der Gewichtungsregeln kann der öffentliche Auftraggeber erheblichen Einfluss darauf nehmen, ob er im Ergebnis der Ausschreibung eine möglichst hochwertige und seinem Bedarf entsprechende Leistung erhält. Die Festlegung des Wertungssystems bietet mithin die Möglichkeit, ein Vergabeverfahren intelligent zu gestalten. Andererseits stellt sich die Frage, in welcher Differenziertheit und Tiefe das Bewertungssystem des öffentlichen Auftraggebers ausgestaltet sein muss. Ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, im Vorhinein ein bis in letzte Unterkriterien und deren Gewichtung gestaffeltes Wertungssystem aufzustellen?
-
Haben Sie es auch schon bemerkt? In der neuen VOL/A 2009 sucht man vergeblich nach der Regelung zum Verbot eines ungewöhnlichen Wagnisses zu Lasten der Bieter (vgl. § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A 2006). Dies ist umso erstaunlicher, als in § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2009 weiterhin bestimmt wird, dass dem Auftragnehmer kein ungewöhnliches Wagnis für Umstände und Ereignisse aufgebürdet werden darf, auf die er keinen Einfluss hat und deren Entwicklung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. Eine durchaus wirkungsvolle Regelung zum Schutze der Bieter vor Willkürhandlungen der öffentlichen Auftraggeber. Die gleich lautende Regelung des § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A 2006 dürfte daher auch nicht einfach überflüssig geworden sein – oder doch?
-
Serie Zuschlagskriterien im Vergabeverfahren – Teil 2: Trennung von Zuschlags- und Eignungskriterien
In Teil 1 der Beitragsreihe wurde bereits dargestellt, dass der Auswahl der Zuschlagskriterien im Vergabeverfahren eine besondere Bedeutung zukommt. Mit Gesichtspunkten wie Preis, Qualität, technischer Wert usw. kann der öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung die Eigenschaften der angebotenen Leistung bewerten und somit sicherstellen, dass er eine seinem Bedarf entsprechende Leistung erhält. Hiervon zwingend zu unterscheiden ist die nach § 19 Abs. 5 EG VOL/A 2009 bzw. § 16 Abs. 5 VOL/A 2009 erforderliche Prüfung der Eignung der Unternehmen. Eignungsprüfung einerseits und Wirtschaftlichkeitsprüfung andererseits stellen zwei verschiedene Vorgänge dar.
-
Aufgrund seiner Regelungstiefe bietet das Vergaberecht den öffentlichen Auftraggebern nur in beschränktem Maße die Möglichkeit, ein Vergabeverfahren nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Soweit die Vergabevorschriften einen gewissen Handlungsspielraum gewähren, sollte daher ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet werden. Dies gilt insbesondere auch für die Auswahl der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung. Denn letztlich entscheidet vor allem das vom öffentlichen Auftraggeber festgelegte Wertungssystem darüber, ob er im Ergebnis der Ausschreibung eine möglichst hochwertige und seinem Bedarf entsprechende Leistung erhält oder nicht. Die folgenden Ausführungen sind der Beginn einer aktualisierten Beitragsreihe, die sich mit den wesentlichen Fragen betreffend der Zuschlagskriterien beschäftigt.
-

Es war spannend zu sehen, wie die Vergabekammern mit der Forderung des EuGH umgehen werden, wonach vergaberechtliche Ausschlussfristen „hinreichend genau, klar und vorhersehbar“ sein müssen. Zumal der EuGH mit dieser Forderung eine britische Norm für europarechtswidrig erklärt hatte, nach der die Einleitung eines (Nachprüfungs-) Verfahrens nur dann zulässig ist, wenn „das Verfahren unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten … eingeleitet wird“ (EuGH, Urteil vom 28.10.2010 – Rs. C-406/08). Immerhin ist die Entscheidung auf eine Schlüsselvorschrift des deutschen Vergaberechts übertragbar – und zwar auf § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB, der eine „unverzügliche“ Rüge verlangt. Das sieht die Vergabekammer des Bundes (VK Bund, Beschluss v. 5.3.2010 – VK 1-16/10) in einer aktuellen Entscheidung jedoch gründlich anders.
-

Eine wesentliche Neuregelung der vor knapp einem Jahr in Kraft getretenen GWB-Novelle stellt § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB dar. Danach ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Bereits im laufenden Gesetzgebungsverfahren wurde in der Vergaberechtsliteratur diskutiert, inwieweit die Anwendung der 15-Tage-Frist einen Hinweis in der Vergabebekanntmachung voraussetzt oder nicht. Diese Frage war in jüngster Vergangenheit auch Gegenstand verschiedener Vergabenachprüfungsverfahren.
-

Wie heisst es doch: Die Zeit heilt alle Wunden. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 21.01.2010 – Rs. C-17/09) gilt dies allerdings nicht für Vergaberechtsfehler. 13 Jahre nach Abschluss des Vertrages über die Entsorgung von Biomüll und Grünabfällen zwischen der Stadt Bonn und der Müllverwertung Bonn GmbH stellt der EuGH fest: Die Vergabe war europarechtswidrig. Der Auftrag hätte nicht ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens mit öffentlicher Ausschreibung erteilt werden dürfen und ist daher umgehend zu beenden.
-

Nach § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB muß der Bieter einen Vergaberechtsverstoß unverzüglich rügen. Allgemeiner Maßstab für die Rügefrist sind 3 Kalendertage. Von Ausnahmen abgesehen, sind die Bieter damit auf der sicheren Seite. Allerdings wird oft verkannt, dass die Rüge nicht nur innerhalb der 3-Tagesfrist versandt, sondern dem Auftraggeber auch innerhalb dieser Frist tatsächlich zugegangen sein muss. Welche Voraussetzungen hierbei zu erfüllen sind, wurde in verschiedenen Beschlüssen der vergaberechtlichen Nachprüfungsinstanzen näher konkretisiert:
-

Haben Sie es auch schon bemerkt? In dem verabschiedeten Entwurf zur VOL/A 2009 sucht man vergeblich nach der Regelung zum Verbot eines ungewöhnlichen Wagnisses zu Lasten der Bieter (vgl. § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A 2006). Dies ist umso erstaunlicher, als in § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2009 weiterhin bestimmt wird, dass dem Auftragnehmer kein ungewöhnliches Wagnis für Umstände und Ereignisse aufgebürdet werden darf, auf die er keinen Einfluss hat und deren Entwicklung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. Eine durchaus wirkungsvolle Regelung zum Schutze der Bieter vor Willkürhandlungen der öffentlichen Auftraggeber. Die gleich lautende Regelung des § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A 2006 dürfte daher auch nicht einfach überflüssig geworden sein – oder doch?
-

Nicht erst seit dem Inkrafttreten der neuen Sektorenverordnung gewährt das Vergaberecht Auftraggebern, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind (vgl. zum Begriff der Sektorenauftraggeber § 98 Nr. 4 GWB), große Handlungsspielräume. In diesem Zusammenhang sei allein auf die freie Wahl der Vergabeverfahren verwiesen (vgl. § 6 SektVO). Hierdurch erhalten die Vergabestellen eine Flexibilität, die außerhalb des Sektorenbereichs oft vermisst wird. Wo auch diese Handlungsspielräume ihre Grenze finden, hat zuletzt das OLG München in seinem Beschluss vom 29.09.2009 entschieden.
-
Die EU-Kommission hat mit Verordnung 1177/2009 vom 30.11.2009 neue Schwellenwerte für die Vergabe öffentlicher Aufträge festgelegt. Die Verordnung tritt am 01.01.2010 in Kraft.
Netzwerk-Login