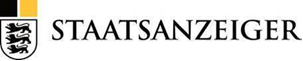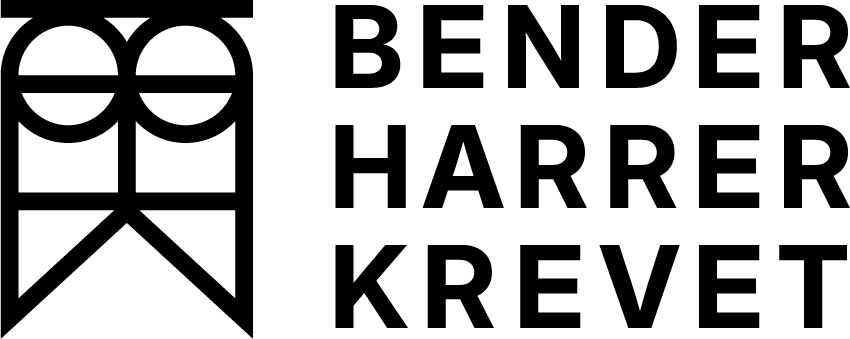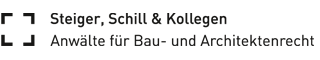Kategorie:
Reform
-
Update 29.03.: Der federführende Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten, der Verkehrsausschuss und der Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung des Bundesrats hatten insgesamt 16 Änderungsvorschläge eingebracht (BR-Drucksache 40/1/10 vom 15.03.2010). Hiervon wurden auf der Bundesratssitzung am 26. März 12 Änderungsvorschläge angenommen. Den Beschluss des Bundesrates – BR-Drucksache 40/10 (Beschluss) – vom 26. März finden Sie hier.
-
Auch kleine Änderungen können von Bedeutung sein. Im heutigen Teil 4 unserer Serie “Die neue VOL/A” geht es um eine solche, erst auf den zweiten Blick bedeutsame Änderung. Gem. § 8 Nr. 3 Abs. 5 VOL/A 2006 ist die Ausschreibung “produktneutral”, d.h. insbesondere ohne Verwendung von Markennamen oder Bezeichnungen, die Rückschlüsse auf die Produkte eines bestimmten Herstellers/ Anbieters zulassen, zu formulieren. Eine Auflage, die insbesondere im technischem Umfeld Beschaffer nicht selten vor große Herausforderungen stellt (s. dazu auch den vorangehenden Beitrag Leitfaden zur produktneutralen Beschaffung von Desktop-PCs aktualisiert). So soll sichergestellt werden, dass nicht durch diskriminierende Formulierungen bestimmte Bieter ausgeschlossen werden – sei es ungewollt oder mitunter auch gewollt. Eine sinnvolle Vorschrift, die in ihrer praktischen Anwendung aber nicht selten zu kuriosen Folgen führte – so z.B., wenn eine Behörde über 50 identische Server der Firma PH verfügte, und nun der 51 Server produktneutral beschafft werden sollte – technische Einbindung, Schulungen des Personals, etc. fraßen oft jede Wirtschaftlichkeit auf. Auch die Rechtsprechung legte den Beschaffern für Ausnahmen vom Grundsatz der Produktneutralität hohe Hürden vor. Die neue VOL/A schafft für solche Fälle nun zumindest im Unterschwellenbereich – und damit immerhin bis zu einem Auftragswert von 193.000 Euro bzw. 125.000 Euro bei Obersten oder Oberen Bundesbehörden sowie vergleichbarer Bundeseinrichtungen – eine praxisgerechte Ausnahmeregelung.
-
Nein, auch wenn heute die CeBIT ihre Tore öffnet, soweit ist es dann doch noch nicht. Allerdings könnte iPhone Hersteller Apple durchaus darüber nachdenken: Die neue VOL/A 2009 sieht zum Zweck des Bürokratieabbaus in § 3 Abs. 6 VOL/A 2009 die neue Möglichkeit des sog. „Direktkaufs“ ohne ein Vergabeverfahren vor.
-
In unserer ersten Folge zur neuen VOL/A 2009 wurden die Änderungen im Aufbau und der Struktur erläutert. Nun geht es an die Inhalte. Zwar blieb die letztendliche Umsetzung des Entwurfs aus der Feder des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie aufgrund des im Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Dienstleistungen (DVAL) herrschenden Konsensprinzips hinter den Ausgangsvorschlägen des Ministeriums zurück. Gleichwohl machte dieses seinem Namen “für Wirtschaft” alle Ehre: Im Unterschwellenbereich, in dem sich die weitüberwiegende Anzahl der Vergabeverfahren abspielt – konnte die Transparenz bei der Auftragsvergabe deutlich erhöht werden.
-

Eine wesentliche Neuregelung der vor knapp einem Jahr in Kraft getretenen GWB-Novelle stellt § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB dar. Danach ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Bereits im laufenden Gesetzgebungsverfahren wurde in der Vergaberechtsliteratur diskutiert, inwieweit die Anwendung der 15-Tage-Frist einen Hinweis in der Vergabebekanntmachung voraussetzt oder nicht. Diese Frage war in jüngster Vergangenheit auch Gegenstand verschiedener Vergabenachprüfungsverfahren.
-
Der neue § 97 Abs. 4 a GWB sowie § 6 Abs. 4 VOL/A 2009 bzw. § 7 Abs. 4 EG VOL/A 2009 sehen nun – wie bereits seit langem § 8 Nr. 3 Abs. 2 VOB/A – die Möglichkeit der Präqualifizierung (PQ) der Bieter vor. PQ – also die vorgelagerte, auftragsunabhängige Prüfung der Eignungsnachweise – soll den Unternehmen erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse bringen. Als erstes bundesweites PQ-System für den Liefer- und Dienstleistungsbereich haben die Industrie- und Handelskammern bzw. die von ihnen getragenen Auftragsberatungsstellen im September 2009 die “bundesweite Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich” ins Leben gerufen. Schon seit 2 Jahren nimmt die Auftragsberatungsstelle (ABSt) Hessen die Aufgabe einer regionalen Präqualifizierungsstelle wahr. Dort wurde Ende 2009 bereits das 200. Unternehmen zertifiziert. Entscheidend ist dabei jedoch, ob auch die öffentlichen Auftraggeber die PQ akzeptieren – eine hessische Zwischenbilanz.
-
Am 29. Dezember letzten Jahres wurde die neue VOL/A 2009 im Bundesanzeiger bekannt gemacht und harrt aktuell ihres In-Kraft-Tretens durch die neue Vergabeverordnung bzw. die Einführungserlasse der Bundesländer. Was aber wurde genau in den insgesamt elf Arbeitssitzungen des zuständigen DVAL-Hauptausschuss Allgemeines von Oktober 2007 bis Oktober 2009 über den Titel “Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen“ statt bisher “Verdingungsordnung für Leistungen” hinaus geändert? Grund genug und Anlass für den Vergabeblog, eine Serie zu den wichtigsten Änderungen der Novelle zu beginnen. Im heutigen Teil 1 geht es um die Reform der Struktur, die weit mehr als eine bloße Schönheits-OP war. Tipp: Nutzen Sie doch die Druckfunktion unter jedem Artikel, so haben Sie am Ende eine kompakte Übersicht der Reform griffbereit im Regal.
-
Das Bundeskabinett hat heute dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vorgelegten Entwurf einer aktualisierten Vergabeverordnung (VgV) zugestimmt. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Die neue VgV ist erforderlich, um durch die in ihr enthaltenen Verweise die VOL/A 2009 und VOB/A 2009 in Kraft treten zu lassen. Damit wird dann die sog. 3. Stufe der Vergaberechtsreform und mit ihr die Reformaktivitäten der 16. Legislaturperiode zur Vereinfachung des Vergaberechts abgeschlossen. Ausweislich des Koalitionsvertrags wird es nicht die letzte Reform gewesen sein.
-
„72 Prozent der Fach- und Führungskräfte in der Öffentlichen Verwaltung sind unzufrieden mit dem Abbau unnötig komplizierter Abläufe in ihren Behörden“ titelt heute eGovernment Computing. Als Bürokratieverursacher machen sie in erster Linie die Gesetzgebung verantwortlich: „Besserung sei nicht in Sicht.“
-

Haben Sie es auch schon bemerkt? In dem verabschiedeten Entwurf zur VOL/A 2009 sucht man vergeblich nach der Regelung zum Verbot eines ungewöhnlichen Wagnisses zu Lasten der Bieter (vgl. § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A 2006). Dies ist umso erstaunlicher, als in § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A 2009 weiterhin bestimmt wird, dass dem Auftragnehmer kein ungewöhnliches Wagnis für Umstände und Ereignisse aufgebürdet werden darf, auf die er keinen Einfluss hat und deren Entwicklung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. Eine durchaus wirkungsvolle Regelung zum Schutze der Bieter vor Willkürhandlungen der öffentlichen Auftraggeber. Die gleich lautende Regelung des § 8 Nr. 1 Abs. 3 VOL/A 2006 dürfte daher auch nicht einfach überflüssig geworden sein – oder doch?